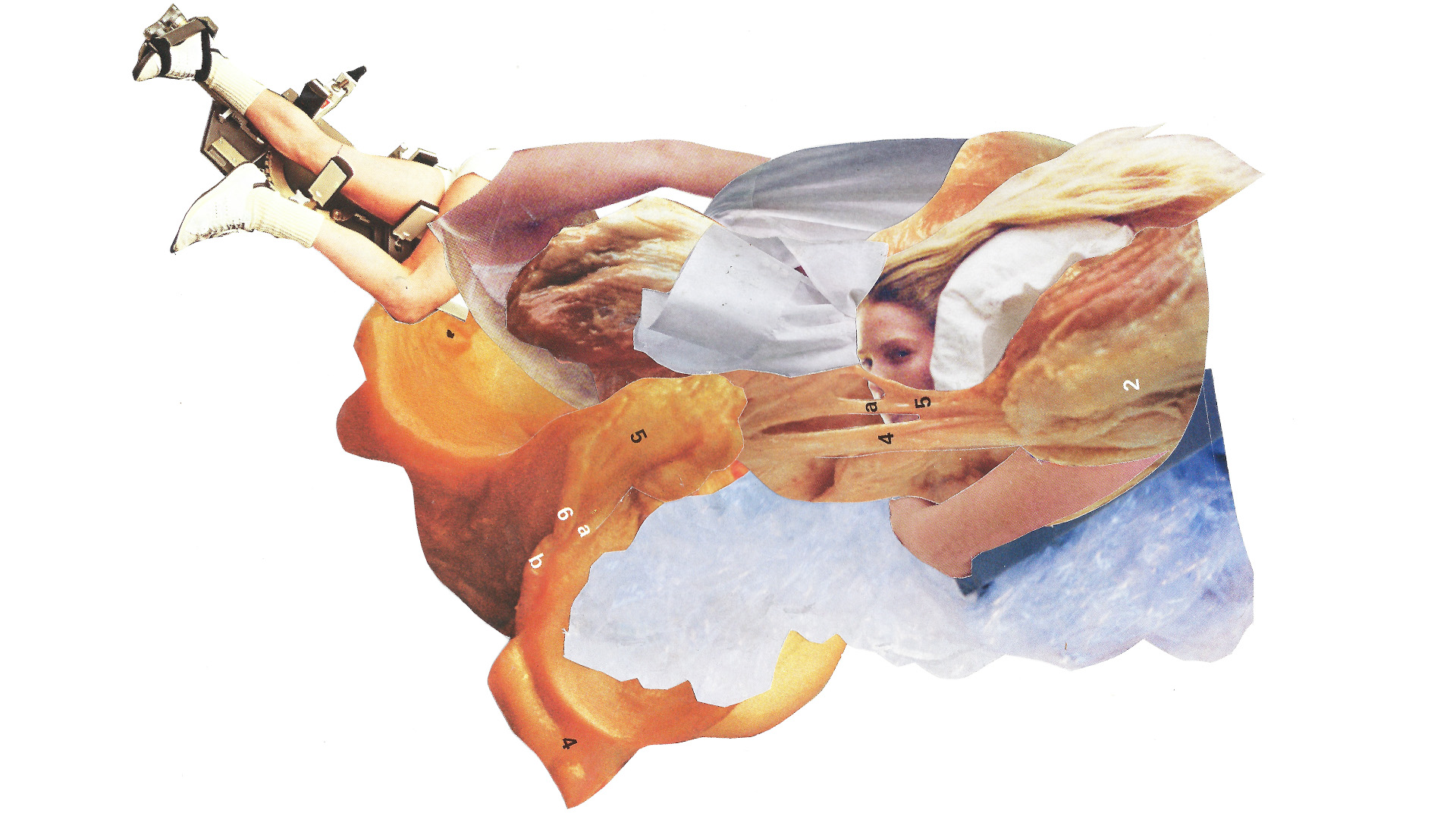Ein praktischer Blick auf das Modell der Salutogenese
Von Isabelle Horster
Für mich als Assistenzärztin in der Inneren Medizin eines kleinen Krankenhauses steht aktuell eine pathogenetische Herangehensweisebei der Diagnosestellung und der Behandlung von Patient*innen im Vordergrund.
Unter hohem Zeitdruck beiZuständigkeit für ca. 14 Patient*innen ist es eine tägliche Herausforderung, das bio-psycho-soziale Modell in der Krankheitsentstehung zu adressieren. Bei der Fülle an täglichen Aufgaben und meinem begrenzten Arbeitstag ist es ein permanenter Zeitkonflikt, sich im Sinne einer „personen-zentrierten“ Versorgung, Zeit für die Evaluation der individuellen Präferenzen, Bedürfnisse und Werte der Menschen zu nehmen und zur individuellen Gesundheitsförderung beizutragen. Wenngleich die Berücksichtigung des bio-psycho-sozialen Modells und eine Patient*innen zentrierte Versorgung zur evidenzbasierten Medizin zu zählen sind, scheint die Umsetzung bei der ökonomischen Fokussierung des Gesundheitswesens systemisch nicht gewollt zu sein. Das führt zu Widersprüchlichkeiten, mit denen ich mich als Assistenzärztin allein gelassen fühle. Zwei Fragen gaben den Anlass für diesen Artikel: Wie kann ich in diesem System gesund bleiben und wie kann ich die Gesundheit der sich in Behandlung befindenden Menschen nachhaltig fördern?
Im Folgenden möchte ich das Modell der Salutogenese charakterisieren, um anschließend einen Ausblick zu wagen und den Bogen zu meiner Tätigkeit als Assistenzärztin zu schließen.
Das Modell der Salutogenese kann den psychosozialen Modellen von Krankheit und Gesundheit zugeordnet werden (Klemperer, 2020, S. 67ff.)1. Aaron Antonovsky, als Begründer der Salutogenese, hat bei der erfolgreichen Bewältigung von Stressoren den Begriff des sense of coherence (SOC, Kohärenzgefühl) geprägt. Das SOC trägt mit Hilfe eines kognitiv-emotionalen Verarbeitungsmusters und motivationalen Aspekten auf der Basis generalisierter Widerstandsressourcen dazu bei, ein Gefühl der Verstehbarkeit, der Handhabbarkeit und der Sinnhaftigkeit in der jeweiligen Situation zu entwickeln (Mittelmark, 2022, S.59ff.; Klemperer, 2020, S. 74ff.). Zu den generalisierten Widerstandsressourcen zählen soziale, kulturelle und psychologische Ressourcen wie das Bildungsniveau, finanzielle Ressourcen, die Wohnumgebung, tiefe und stabile Bindungen zu Mitmenschen sowie institutionalisierte Bindungen zwischen dem*der Einzelnen und der Gesellschaft, die für die Bewältigung unterschiedlichster Herausforderungen hilfreich sein können. (Mittelmark, 2022, S.30ff).
Gesundheit und Krankheit werden als Kontinuum verstanden, während in der pathogenetischen Herangehensweise Gesundheit und Krankheit als dichotom gelten. Egal an welchem Pol zwischen Gesundheit und Krankheit sich eine Person befindet, das Ziel der Anwendung des Modells der Salutogenese liegt in einer Verschiebung des subjektiven Wohlbefindens hin zum Pol Gesundheit. Im Vordergrund stehen die Autonomieförderung und die Mobilisierung von Ressourcen sowie die Förderung eines SOC2. Dies geschieht immer in der Wechselwirkung von körperlichen/psychischen Voraussetzungen mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, sozialen Beziehungen, Unterstützungserfahrungen und der eigenen Identität (vgl. Maass, 2024).3
Trotz aller medizinischen Errungenschaften der letzten Jahrhunderte bleiben viele Erkrankungen nicht heilbar und auch mit den Möglichkeiten der Linderung stoßen wir immer wieder an unsere Grenzen. Im Konzept der Salutogenese stehen diese Errungenschaften nicht an erster Stelle.
Ein Gesundheitswesen, das die Entstehung von Krankheiten dem gesellschaftlichen Kontext entzieht, führt zu einer Vernachlässigung der komplexen Zusammenhänge zwischen Individuum und Gesellschaft in der Krankheitsentstehung und Erfahrung von Gesundheit.
Das Modell der Salutogenese kann uns helfen, Patient*innen dabei zu unterstützen, eine Gesundheit zu bilden, die die Fähigkeit hat, »mit sozialen, körperlichen und emotionalen Herausforderungen umzugehen und selbstbestimmt mit ihnen zu leben«4 . Dies geschieht, um es nochmal zu betonen, immer in der Wechselwirkung von körperlichen/ psychischen Voraussetzungen mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, sozialen Beziehungen, Unterstützungserfahrungen und der eigenen Identität (vgl. Maass, 2024).5 Gesundheit ist nicht individualisierbar.
Damit die Gesundheitsförderung möglich ist, braucht es zwischenmenschliche Bindung auf der Basis einer „Gleich-Würdigkeit“, mit einer Hochachtung des Gegenüber und der dafür notwendigen Zeit. Eine Form dieser Bindung kann die Beziehung zwischen Mitarbeitenden der Gesundheitsberufe und den aufsuchenden Personen darstellen. Diese besteht in der Regel im Krankenhaus deutlich kürzer als im ambulanten Gesundheitssektor.6 Der ökonomische Profit oder allgemein die Wirtschaftlichkeit stehen in der Regel im direkten Widerspruch zu zwischenmenschlicher Bindung und der dafür notwendigen Zeit. Ein Aspekt, der die Möglichkeiten der Gesundheitsförderung und ‑bildung im Krankenhaus limitiert. Gleichzeitig bleibt in jeder zwischenmenschlichen Interaktion ein Gestaltungspielraum bestehen, den wir täglich ausfüllen können.
Corinne Scherwarth hat in ihrem Essay „When you are ready for us, we are ready for you” ihre positive Bindungserfahrungen als Patientin in einem dänischen Krankenhaus bei einer notfallmäßigen Vorstellung im Rahmen einer Blinddarmentzündung niedergeschrieben7. Strukturell wird die Notwendigkeit bindungs-orientierten Arbeitens an deutschen Krankenhäusern und allgemein im Gesundheitswesen nicht mitgedacht. Bindungsorientiertes Arbeiten wäre ein wesentlicher gesundheitsförderlicher Ansatz für Mitarbeitende und Aufsuchende des Gesundheitssystems, auch in Krankenhäusern. Es ist ein systemisches Phänomen, dass die Beziehungsarbeitund Reflexion von Beziehungen zurückgestellt werden, zugunsten eines technisch-medikalisierten Ansatzes in Bezug auf Gesundheit und Krankheit, welcher sich auch leichter ökonomisieren lässt. Die Förderung von Widerstandsressourcen mit der Stärkung eines SOC erfolgt in der Beziehung zwischen Mitarbeitenden von Gesundheitsberufen und den aufsuchenden Personen naturgemäß auf einer primär individuellen Ebene. Da Widerstandsressourcen sozial und regional ungleich verteilt sind, ist die systemische Förderung eines SOC auf gemeinschaftlicher, regionaler, staatlicher und internationaler Ebene im Rahmen der öffentlichen Gesundheitsfürsorge (Public Health) unerlässlich.
In meiner aktuellen Rolle als Assistenzärztin stehe ich nicht nur unter enormen zeitlichen Druck. Ich möchte meiner Verantwortung gerecht werden, „eine gute Ärztin sein“8 und dabei den Ansprüchen der evidenzbasierten Medizin gerecht werden, sowie meine Patient*innen als Menschen wahrnehmen können. In einem System ohne Fehlerkultur, mit Perfektionismus als Anspruch, Anerkennung durch grenzenlose Leistungs-bereitschaft und fehlendem Raum für eigene Bedürfnisse, die eigene Fehlerhaftigkeit und Selbstbegrenzung, tragen die per se guten hohen Ansprüche, zur grenzenlosen Überforderung bei. Was für eine Herausforderung es ist, in diesem System gesund zu bleiben! Gar kann ich fragen, können wir überhaupt gesund sein, in so einem kranken System?
Modelle sind leider nicht unmittelbar handlungswirksam, es ist ein langwieriger Prozess bis sich soziale Praktiken verändern. Bei den bestehenden Grenzen der individuellen Einflussnahme können wir gemeinsam systemische Veränderungen unterstützen.
Vielleicht sind wir als nachfolgende Generation in einigen Jahren in Positionen, die uns an verschiedenen Stellen des Gesundheitswesens eine systemische Umgestaltung des Arbeitens hin zu einem bindungsorientierten Arbeiten ermöglichen. Bis dahin gilt es, nicht zu resignieren, empathisch „gleich-würdige“ menschliche Interaktionen und Beziehungen mit Leben zu füllen und für eine Gesellschaft mit gesundheitsförderlichen Rahmenbedingungen einzutreten. Wer weiß, in welchen Städten wir weitere solidarische Gesundheitszentren im Sinne des Poliklinik-Syndikats entstehen lassen, die mit interdisziplinären Teams nicht nur die Verhaltens- sondern insbesondere auch die Verhältnisprävention adressieren.
Eine gesundheitsfördernde Grundhaltung im Sinne der Salutogenese kann zu einer Lebenseinstellung werden, die uns dabei unterstützt, gesund zu bleiben und unsere pathogenetischen Kenntnisse in der Diagnosestellung, Behandlung und Forschung im Alltag nachhaltig anzuwenden.
Von Isabelle Horster, Ärztin in Weiterbildung. »Für weiterführende Literatur zu diesem Thema empfehle ich einen Blick in das Buch Der gute Arzt – Lehrbuch der ärztlichen Grundhaltung von Klaus Dörner, erschienen im Schattauer Verlag.«
- David Klemperer: Sozialmedizin – Public Health – Gesundheitswissenschaften: Lehrbuch für Gesundheits- und Sozialberufe, 4. Ed., 2020).. Hogrefe AG 2020 ↩︎
- Klemperer, 2020, S. 74ff. ↩︎
- Ruca Maass: Salutogenese – Ein Ansatz für ganzheitliche Gesundheitsförderung?, in: Der Mensch, Salutogenese – Orientierung inmitten von Krisen?, Heft 64⁄65 3–4/2024, S. 5–7 ↩︎
- (Huber et al. 2011, 2016, 2024) ↩︎
- Ruca Maass: Salutogenese – Ein Ansatz für ganzheitliche Gesundheitsförderung?, in: Ottomar Bahrs: Der Mensch, Salutogenese – Orientierung inmitten von Krisen?, Heft 64⁄65 3–4/2024, S. 5–7 ↩︎
- Bezugnehmend auf das telefonische Gespräch mit Ottomar Bahrs, 1. Vorsitzender des Dachverband Salutogenese, am 27.01.2025, https://dachverband-salutogenese.eu zuletzt aufgerufen 22.01.2025 ↩︎
- .Scherwarth, 2022. https://www.verstehensorientierte-paedagogik.de/veröffentlichungen/publikationen/ zuletzt aufgerufen: 22.01.2025 ↩︎
- Für weiterführende Literatur zu diesem Thema empfehle ich einen Blick in das Buch „Der gute Arzt – Lehrbuch der ärztlichen Grundhaltung“ von Klaus Dörner, erschienen im Schattauer Verlag. ↩︎