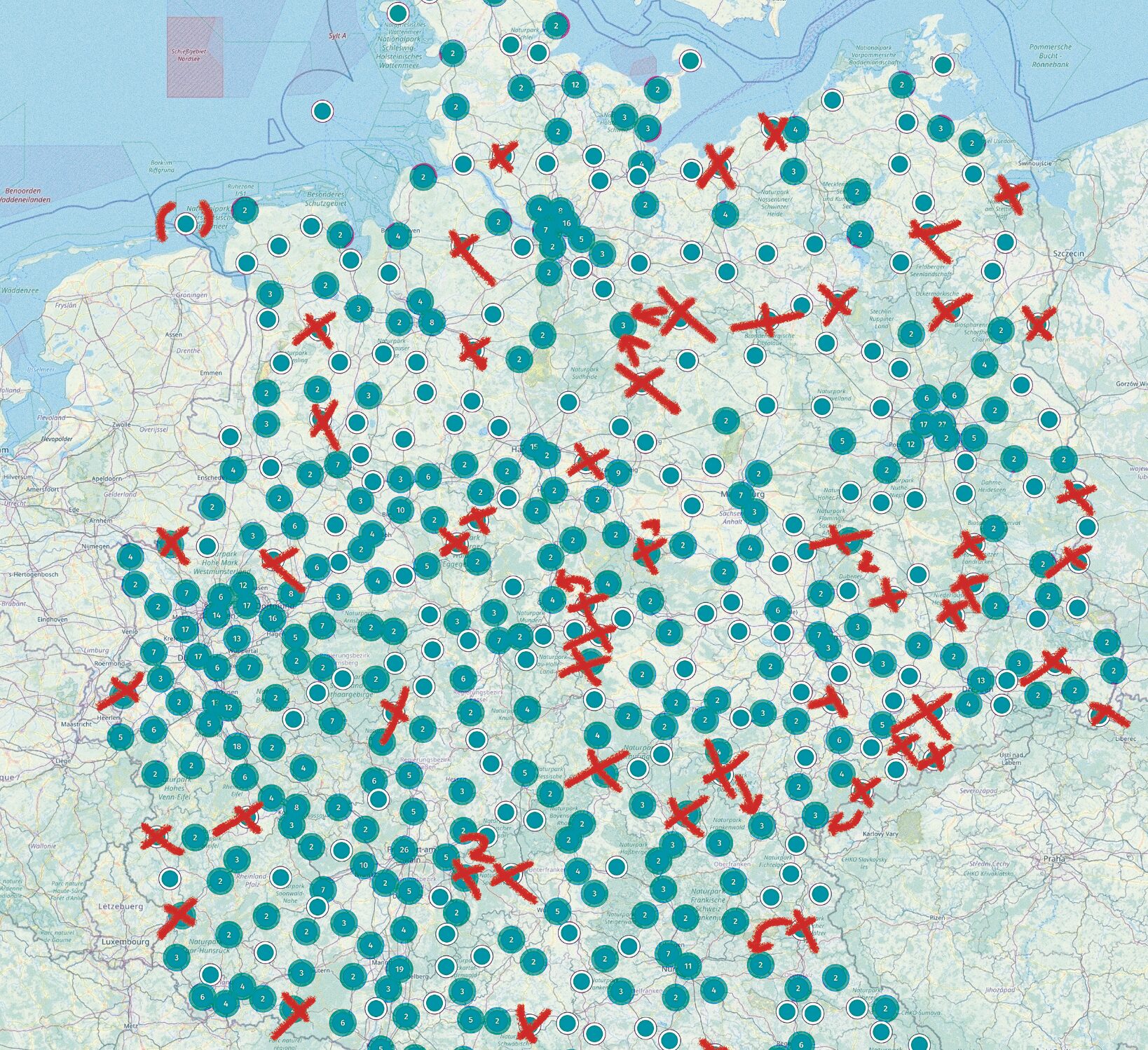Am 06.12.2022 hat die von Bundesgesundheitsminister Lauterbach eingesetzte Regierungskommission ihre Stellungnahme mit dem Titel »Grundlegende Reform der Krankenhausvergütung« vorgelegt. Am 12.12.2024 ist die Umsetzung dieser Empfehlungen, das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG), in Kraft getreten. Thomas Böhm diskutiert es im Namen des Bündnis’ Krankenhaus statt Fabrik.
von Thomas Böhm
Lauterbach hatte die Reform mit großen Worten angekündigt: »Überwindung der DRGs«, »Dramatische Entökonomisierung« »Revolution« waren nur einige Schlagworte. Am 22.03.2024 machte er im Bundesrat folgendes deutlich: »Wir schützen insbesondere die kleinen Krankenhäuser auf dem Land.« Schon etwas anders klang es einige Zeit später: »Wir werden alle Krankenhäuser retten, die wir benötigen« (Lauterbach am 06.04.2024 im Mainecho) und: »Es wird keine Entökonomisierung geben.« (Parlamentarische Staatssekretär Franke am 09.09.2024 auf dem Krankenhausgipfel)
Was den Scharfmachern bei dieser Debatte vorschwebt, wurde auch klar: »Jeder Monat, in dem nicht fünf bis zehn Krankenhäuser vom Netz gehen, ist ein verlorener Monat.« (Wulf-Dietrich Leber, Leiter der Abteilung Krankenhäuser beim GKV-Spitzenverband am 21.03.2024 beim DRG-Forum) oder »Von der Versorgungsqualität würden sogar 400 Krankenhäuser ausreichen.« (Prof. Reinhard Busse am 18.07.2019 in Die Debatte) oder: »Eine starke Verringerung der Klinikanzahl von aktuell knapp 1.400 auf deutlich unter 600 Häuser, würde die Qualität der Versorgung für Patienten verbessern und bestehende Engpässe bei Ärzten und Pflegepersonal mildern.« (Bertelsmann-Stiftung 05.07.2019)
Bei solchen markigen Kampfansagen muss man sich die Ausgangslage klarmachen: Seit 1991 gibt es 659 Krankenhäuser (von damals 2.164) weniger und 183.362 Betten (von damals 598.073) wurden abgebaut. Der Hauptverlust ging zu Lasten der öffentlichen Krankenhäuser, die Privaten haben ihre Bettenzahl seither annähernd vervierfacht.1
Die ehrgeizigen Ziele des geplanten Abbaus sollen im Gesetz über Strukturregelungen und Vergütungsregelungen erreicht werden. Diese zusammenfassende Bewertung konzentriert sich auf die wesentlichen Teile des Gesetzes, nämlich die Einführung von Leistungsgruppen, von »Mindestzahlen« und von »Sektorenübergreifenden Versorgungseinrichtungen«. Hinzukommt die Vorhaltevergütung.
Leistungsgruppen
Es werden 65 Leistungsgruppen (LG) und bundeseinheitliche Qualitätskriterien eingeführt. Die Leistungsgruppen lassen sich grob in LG der Grundversorgung (z.B. Allgemeine Innere, Allgemeine Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Pädiatrie), der Zentralversorgung (z.B. Gastroenterologie, Endoprothetik, Nephrologie) und der Maximalversorgung (z.B. Leukämie und Lymphome, Lebereingriffe) unterteilen. Die Qualitätskriterien beziehen sich auf die sachliche (z.B. Labor, CT) und personelle Ausstattung (z.B. Zahl der Ärzt*innen und Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung) und sonstige Struktur- und Prozesskriterien. Außerdem werden »verwandte Leistungsgruppen« definiert, die nur gemeinsam erbracht werden dürfen. Kernpunkt ist, dass bei Nichterfüllung keine Zuweisung der LG durch das Land erfolgen darf und dass keine Behandlung von Patient*innen außerhalb der zugewiesenen LG zulässig ist. Alle Festlegungen beziehen sich auf die einzelnen Standorte2 der Krankenhäuser: Bestimmte Qualitätskriterien können auch in Kooperation mit anderen Standorten oder Krankenhäusern erbracht werden.
Ausnahmegenehmigungen durch die Länder bei Abweichungen von den Qualitätskriterien sind nur in einem sehr begrenzten Rahmen möglich: Zum einen bei kurzfristigen Abweichungen, die innerhalb von maximal sechs Monaten behoben werden können, zum anderen für maximal drei Jahre, wenn das Krankenhaus für die flächendeckende Versorgung zwingend notwendig ist.3
Das Bundesgesundheitsministerium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrats eine Rechtsverordnung zur Weiterentwicklung der LG und der Qualitätskriterien zu erlassen. Es kann auch Festlegungen darüber treffen, dass für bestimmte LG Ausnahmegenehmigungen nicht zulässig sind. Die Prüfung der Qualitätskriterien an jedem Standort wurde dem Medizinischen Dienst (MD) übertragen und muss anfangs nach zwei Jahren und dann alle drei Jahre wiederholt werden.
Bewertung Leistungsgruppen
LG sind aus unserer Sicht grundsätzlich richtig. Wenn man nicht finanziell (über Preise) steuern will, muss man planen. Zum Planen gehören Kriterien und Bedingungen. Die nähere Definition des Versorgungsauftrags verhindert auch, dass jedes Krankenhaus/jede Abteilung alles macht, auch wenn es/sie von den Voraussetzungen her dazu nicht geeignet ist. Die Bundesländer haben seit dem ideologischen Siegeszug des Neoliberalismus in den 80er Jahren die Krankenhausplanung mehr oder weniger vollständig eingestellt. Markt und Preise sollten es richten. Daseinsvorsorge kann man aber nicht dem Markt überlassen, sonst wird sie zum Geschäft und zum Wirtschaftszweig.
Aber: Es besteht die Gefahr, dass solche Kriterien wie jetzt bei den LG zum Bettenabbau und zu Krankenhausschließungen missbraucht werden. Diese Gefahr ist real, denn die Länder verfolgen – trotz ihres Widerstandes gegen bestimmte Regelungen des KHVVG – keine anderen Ziele, wie die Entwicklung der Krankenhausschließungen und des Bettenabbaus beweist. Beim Streit mit dem Bund ging es im Wesentlichen darum, wer bei diesem Abbau-Prozess den Hut aufhat, nicht um die Verhinderung des Abbaus. Die Gefahr des Missbrauchs lässt sich am ehesten dadurch mindern, dass die Krankenhausplanung demokratisch (unter Beteiligung aller Betroffenen, auch der Patient*innen und Beschäftigten) und möglichst regional (in Versorgungsregionen) und nicht vom grünen Tisch her erfolgt.
Die Übertragung der Prüfung der Qualitätskriterien an den Medizinischen Dienst ist ebenfalls nicht richtig. Einmal abgesehen davon, dass der MD – auch wenn er nicht mehr so heißt – immer noch ein Dienst der Krankenkassen ist (von ihnen wird er zu 100% finanziert), liegt der Sicherstellungsauftrag für die Versorgung (und damit auch für die Qualität der Versorgung) beim Land. Dementsprechend muss auch das Land diese Qualität überprüfen. Durch die Abgabe dieser Aufgabe wird die Planungshoheit der Länder (die ja die Versorgung sicherstellen soll) eingeschränkt und die Kassen erhalten (indirekt) Einfluss auf die Planung.
Lauterbach hat ja zu den Zielen seiner Reform auch die »Entbürokratisierung« erklärt. Was aber droht, ist eine deutliche Ausweitung der Bürokratie im Zusammenhang mit den Leistungsgruppen (Nachweis, dass man die jeweiligen Bedingungen erfüllt, Kontrollen durch den Medizinischen Dienst, Streitigkeiten um die Erfüllung der Bedingungen). In Bezug auf den DRG-Bereich ändert sich in Hinblick auf die Bürokratie natürlich überhaupt nichts.
Mindestzahlen
Da die Wirkung der LG Lauterbach offensichtlich noch nicht ausreichend war, hat er »Mindestvorhaltezahlen« als weiteres Selektionsinstrument eingeführt. Für jede Leistungsgruppe soll eine Mindestzahl an durchgeführten Behandlungen notwendig sein, damit der Standort die Vorhaltevergütung (s.u.) erhält. Zusätzlich sollen bei onkochirurgischen Leistungen ebenfalls Mindestzahlen von Leistungen für einen »Indikationsbereich« (leistungsgruppenübergreifend) gelten. Hier wird dann bei Unterschreiten zwar die Vorhaltevergütung aber nicht die »Rest«-DRG vergütet. Berechnet wird diese Mindestzahl durch Festlegung eines Prozentsatzes aller Fälle. Bei der Mindestvorhaltezahl liegt der Prozentsatz noch nicht fest. Er soll noch in diesem Jahr in einer Rechtsverordnung (mit Zustimmung der Länder) bestimmt werden. In der Gesetzesbegründung war von 20% aller Fälle die Rede. Bei den onkochirurgischen Leistungen legt das Gesetz selbst sie mit 15% aller Fälle fest. Welche Standorte betroffen sind, ergibt sich dadurch, dass alle Standorte in einem Bundesland, die die jeweilige Leistungsgruppe bzw. die onkologischen Leistungen erbringen, aufsteigend nach der Zahl der Fälle sortiert werden, bis die Gesamtzahl der von ihnen behandelten Fälle die festgelegte Grenze überschreitet.
Bewertung Mindestzahlen
Der finanzielle Effekt ist in beiden Fällen ähnlich: Mit nur noch ca. 50% der Vergütung lässt sich die Leistung nicht mehr erbringen, ohne riesige Defizite aufzubauen. Es besteht der Zwang zur Aufgabe der Leistungsgruppe bzw. der onkochirurgischen Leistungen und ggf. zur Schließung des Standortes. Es handelt sich also um eine nochmalige massive Intervention zur Leistungskonzentration.
Es gibt bisher schon Mindestmengen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G‑BA), z.B. für Nierentransplantationen oder die Versorgung von Frühgeborenen. Diese beziehen sich nur auf einzelne Eingriffe und werden nur mit wissenschaftlichem Nachweis eines Zusammenhangs zwischen Fallzahl und Qualität erlassen. Diese Mindestzahlen sind sinnvoll.
Dagegen beziehen sich die Mindestzahlen des KHVVG auf ganze LG bzw. Indikationsbereiche also auf hunderte bis tausende verschiedene Eingriffe. Damit kann es keinen wissenschaftlichen Nachweis eines Zusammenhangs geben. Es handelt sich um ein reines Selektionsinstrument.
Die Berechnungsart bei den Mindestvorhaltezahlen bedeutet auch, dass bei der nächsten Berechnung weitere KH betroffen sind, wenn welche wegfallen. Außerdem setzt die Regelung einen Anreiz zur Mengenausdehnung an der unteren Grenze, wenn Krankenhäuser versuchen die Grenze zu überwinden. Paradox ist auch, dass ein Krankenhaus, das zwar Q‑Kriterien erfüllt, aber nicht die Mindestzahlen faktisch von der Versorgung ausgeschlossen wird.
Zumindest in Bezug auf die Mindestvorhaltezahl besteht noch die Möglichkeit, die hierfür notwendige Rechtsverordnung durch politischen Widerstand zu verhindern. Dies sollte unbedingt geschehen.
Sektorenübergreifende Versorgungseinrichtung
Sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen (SüV) betreffen Standorte von Krankenhäusern, die vom Land bestimmt werden. Ihre Leistungen sind
- ambulante Leistungen aufgrund einer Ermächtigung zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung4
- ambulantes Operieren
- vereinbarte Stationäre Leistungen
- Übergangspflege und Kurzzeitpflege
Stationäre Leistungen dürfen nur in dem Umfang erbracht werden, der in einer Vereinbarung zwischen Deutscher Krankenhaus Gesellschaft (DKG) und Kassen auf Bundesebene vereinbart wurde und die (ebenfalls vereinbarten) Qualitätskriterien erfüllt werden. Die Vergütung der ambulanten Leistungen der SüV erfolgt nach den geltenden Bestimmungen für den niedergelassenen Bereich, den Pflegebereich und für ambulante Operationen. Der stationäre Bereich wird über degressive Entgelte pro Tag vergütet, die zwischen den Kassen und dem einzelnen Krankenhaus ausgehandelt werden.
Bewertung sektorenübergreifende Versorgungseinrichtung
Bei den SüV handelt es sich nicht mehr um Krankenhäuser mit Grundversorgungsaufgaben. Sie sind eine Mischung aus Kurzzeitpflegeheim, Kleinstkrankenhäusern und ambulanten Einrichtungen. Erklärtes Ziel ist die Nutzung dieser neuen Konstrukte zur Schließung von kleinen Grundversorgern in ländlichen Regionen. Dies sieht man auch daran, dass sie nicht auf die Notfallversorgung ausgerichtet sind (z.B. keine Überwachungsbetten). Die Lücke zwischen dem Hausarztbereich (soweit es diesen überhaupt noch gibt) und dem nächstgelegenen größeren Krankenhaus bleibt bzw. wird noch größer.
Sie überwinden auch nicht die sektorale Trennung der Versorgung. Für eine solche Überwindung wäre zunächst eine einheitliche Planung der ambulanten und stationären Versorgung durch die Länder (konkret die Versorgungsregionen) und die Aufhebung des Sicherstellungsauftrags an die Kassenärztlichen Vereinigungen notwendig. Eine Überwindung der Trennung ist weiterhin nur möglich, wenn Krankenhäuser das Recht bekommen, ambulant zu behandeln und ambulante Versorgungszentren zu betreiben.
Unter ambulanten Versorgungszentren verstehen wir:
- Einrichtungen der Krankenhäuser
- gleichmäßig in der Versorgungsregion verteilt
- erste Anlaufstellen für die Notfallversorgung
- Überwachungsbetten und Eingriffsräume sowie alle notwendigen diagnostischen Einrichtungen vorhanden
- wichtige medizinischen Fachrichtungen auf Facharztniveau vorhanden
- über Telemedizin an das Krankenhaus angebunden
- turnusmäßig mit Beschäftigten der Krankenhäuser betrieben
Zusätzlich müssten die Notarztstandorte (incl. Hubschrauber) deutlich ausgebaut werden um die Prähospitalzeiten (ab Alarmierung bis Versorgung im Krankenhaus) zu verkürzen. Nur so kann die flächendeckende Versorgung in ländlichen Gebieten auf hohem Niveau gewährleistet werden. Bevor solche alternativen Strukturen nicht aufgebaut sind darf es keine Schließungen geben.
Degressive Tagesentgelte sind auch Preise, nicht für den einzelnen Fall, sondern für den Tag. Es handelt sich also auch um eine Form der finanziellen Steuerung mit all ihren Fehlanreizen. Es findet lediglich ein Tausch der finanziellen Anreizsysteme mit (teilweise) anderer Zielrichtung statt: Es besteht weiterhin ein starkes Interesse an Personalkostendumping und an einer möglichst billigen Versorgung der Patient*innen. Es gibt den Anreiz, die Verweildauern zu verlängern – zumindest, bis die Kosten den degressiven Tagessatz überschreiten. Danach ist es ökonomisch sinnvoll, den Patienten möglichst schnell zu entlassen. Die Folge sind sachfremde Entscheidungen (»es lohnt sich noch/nicht mehr«) statt einer bedarfsgerechten (»kann der Patient aus medizinischer und pflegerischer Sicht entlassen werden«).
Vorhaltevergütung
Jede DRG hat ein Relativgewicht (RG), dass die jeweiligen Kosten der Behandlung ins Verhältnis zu den Kosten der Behandlung der anderen DRGs setzt – z.B. eine Blinddarmentfernung bei Blinddarmentzündung hat das Relativgewicht 2, einer Lebertransplantation das Relativgewicht 30 (Näherungswerte). Der Preis für die Behandlung des jeweiligen Patienten ergibt sich dann aus der Multiplikation dieses Relativgewichtes mit dem so genannten Landesbasisfallwert. Er wird jährlich auf Landesebene zwischen Kassen und Landeskrankenhausgesellschaft nach gesetzlichen Vorgaben ausgehandelt und liegt momentan bei etwa 4.400 Euro.
Aus diesem Relativgewicht werden jetzt 60% für die Vorhaltevergütung ausgegliedert, nachdem die variablen (individuell dem einzelnen Patienten zuordenbaren) abgezogen wurden5. Es gibt also weiterhin eine »Rest-DRG«, die je nach variablem Kostenanteil auf jeden Fall über 40%, vermutlich im Schnitt bei 50–60% liegt.
Daneben gibt es eine zweite »Vorhalte-DRG« mit eigenen Relativgewichten, den so genannten »Vorhaltebewertungsrelationen«. Die Summe all dieser Vorhaltebewertungsrelationen eines Standortes pro Jahr und pro Leistungsgruppe wird wieder multipliziert mit dem Landesbasisfallwert ist dann die Vorhaltevergütung.
Der Unterschied ist also, dass diese zweite DRG nicht pro aktuellem Fall vergütet wird, sondern als jährliche Pauschale basierend auf den Fallzahlen des vorletzten Jahres. Die Auszahlung erfolgt dann pro Patient*in als Abschlagszahlung auf den Jahresbetrag, der dem Standort zusteht. Am Jahresende erfolgt ein Abgleich der zustehenden und der erhaltenen Vorhaltevergütung mit Ausgleich der Differenzen. 2026 ist die Einführung vergütungsneutral. 2027 und 2028 erfolgt eine Konvergenzphase mit einer Anrechnung der Veränderungen von 33% und dann von 66%.
Die bisher schon geltende volle Refinanzierung der Kosten der Pflege am Bett (»Pflegebudget«) ist in dieser Vorhaltevergütung enthalten, am Jahresende wird aber ein eventueller Differenzbetrag zu den tatsächlich entstanden Pflegekosten ausgeglichen.
Die Neuberechnung dieses Jahresbetrages für den einzelnen Standort erfolgt erstmals nach zwei Jahren und dann nur noch alle drei Jahre. Veränderte Fallzahlen gehen nur in die Neuberechnung ein, wenn sie sich im Zwei- bzw. Dreijahreszeitraum um mehr als 20% nach oben oder unten verändert haben. Änderungen in der Fallschwere der behandelten Fälle6 gehen bei jeder Neuberechnung ein.
Bewertung Vorhaltevergütung
Zunächst fällt die ziemlich komplizierte Berechnungsweise auf. Die DRG-Logik und ‑Berechnung soll offensichtlich unter allen Umständen erhalten bleiben. Wenn es tatsächlich um eine Vergütung der Vorhaltung gehen würde, müssten die notwendigen Geldbeträge ganz anders berechnet werden. Die Frage wäre dann, welche Vorhaltungen sind in welcher Leistungsgruppe notwendig und wie hoch ist der dafür benötigte Geldbetrag. Das wäre eine echte Sachsteuerung, statt einer verkappten finanziellen Steuerung. Hinzu kommt: Es bleibt im Wesentlichen bei der Gesamtsumme der Vergütung und damit auch bei der bestehenden Unterfinanzierung und der massiven Finanznot der Krankenhäuser.
Tatsache ist, dass die DRG gerade nicht überwunden werden. Weiterhin werden 40% plus variabler Kostenanteil mit Fallpreisen ausbezahlt. Der Anreiz zur Mengenausdehnung bleibt damit vollständig erhalten bzw. er wird noch größer, weil nur noch dieser Teil der DRG-Vergütung frei gestaltbar ist und weil es einen noch schärferen Konkurrenzkampf um das reduzierte Geldvolumen geben wird.
Aber auch die Vorhaltevergütung selbst ist nicht mengenunabhängig:
- Bisherige Mengensteigerungen führen zu einem Vorteil bei der Erstverteilung.
- Eine Gesamtsteigerung (auch der Fallschwere) bundesweit oder landesweit wirkt sich erhöhend auf die Vorhaltevergütung aus.
- Wenn es gelingt, eine Steigerung der Fallzahlen innerhalb von drei Jahren um jährlich 7%. zu erreichen, erfolgt eine deutliche Erhöhung der Vorhaltevergütung.
Das sogenannte »Upcoding«, also die Patient*innen bei der Abrechnung kränker zu machen, als sie sind, wird in jedem Fall belohnt. Personalkostendumping ist weiterhin lukrativ, denn es erhöht auch bei der Vorhaltevergütung die Gewinne.
Die Vorhaltevergütung ist nicht zweckgebunden. Sie kann also für alles verwendet werden, für Investitionen, die eigentlich die Länder finanzieren müssten, oder für eine Dividende an Kapitaleigner.
Fast unnötig zu sagen, dass natürlich der notwendige Bürokratieaufwand nochmals ansteigt, wenn mit zwei verschiedenen Abrechnungsverfahren gearbeitet werden muss.
Eine der Absurditäten dieser Art von Vorhaltevergütung ist, dass ein Krankenhaus dafür bestraft wird, dass es mehr Fälle behandelt, auch wenn es dies nicht unter finanziellen Aspekten tut, sondern weil z.B. mehr Menschen erkranken.
Das Grundproblem ist, dass finanzielle Steuerung und Geld blind sind gegen die Qualität. Die notwendige und die unnötige Behandlung haben denselben Preis und werden gleich bezahlt. Die Schlussfolgerung aus all dem lautet:
- In der Daseinsvorsorge hat finanzielle Steuerung nichts verloren.
- Notwendig ist Sachsteuerung statt finanzieller Steuerung.
- Notwendig ist auch die Trennung der Vergütung der Leistungserbringer von der Leistungserbringung.
- Im Krankenhausbereich bedeutet das, wir brauchen die Selbstkostendeckung 2.0, die vollständige Abschaffung der DRGs und ein Gewinnverbot.
In Deutschland gab es die Selbstkostendeckung zwischen 1972 und 1984. Alle wirtschaftlich entstandenen Kosten mussten von den Kassen refinanziert werden. Unterjährig erfolgte die Vergütung der Krankenhäuser über tagesgleiche Pflegesätze. Am Jahresende wurde »spitz« abgerechnet: Überzahlungen im Verhältnis zu den entstandenen Kosten mussten zurückgezahlt werden, Unterzahlungen mussten von den Kassen nachfinanziert werden. Gewinne waren damit gesetzlich verboten. Die Kassen hatten das Recht, die Wirtschaftlichkeit zu prüfen. So bestanden keine Anreize zu unnötiger Leistungsausdehnung auf Kosten der Patient*innen und zu (Personal-) Kostendumping.
Ein erster Einstieg in die Selbstkostendeckung wäre es, wenn – wie bei der Pflege am Bett – alle Personalkosten zu 100% refinanziert würden.
Zusammenfassung
In unserer 1. Stellungnahme vom 11.01.2023 zu den Vorschlägen der Regierungskommission hatten wir geschrieben:
»Betrachtet man das Gesamtinstrumentarium, das die Kommission vorschlägt, liegt der starke Verdacht nahe, dass genau dieser Missbrauch das wesentliche Anliegen der Planungsvorschläge ist und damit noch weiterer Bettenabbau und Krankenhausschließungen die Folge sein werden« und: »Die groß angekündigte Finanzierungsreform ist letztlich ein Etikettenschwindel.«
Daran hat sich nichts geändert. Unsere Gesamtbewertung zum KHVVG lautet weiterhin: »Massiver Abbau droht, Finanz-›Revolution‹ fällt aus«.
Auch wenn das KHVVG jetzt verabschiedet wurde, ist der Kampf für eine kostendeckende Krankenhausfinanzierung und um die Abschaffung der DRGs nicht beendet. Auch Änderungen an besonders gefährlichen Teilen des KHVVG (z.B. den Mindestzahlen, eine Verschärfung des Leistungsgruppensystems und der Qualitätskriterien, sowie verbesserte Ausnahmeregelungen), stehen bereits in diesem Jahr an und können von uns beeinflusst werden.
Thomas Böhm war im Klinikum Stuttgart als Chirurg tätig. Dort war er bis 2011 auch Personalratsvorsitzender und ver.di-Bezirksvorsitzender in Stuttgart. Für ver.di ist er Mitglied im Landeskrankenhausauschuss der Landesregierung und im Verwaltungsrat des Klinikums Stuttgart. Er arbeitet aktiv im Bündnis Krankenhaus statt Fabrik mit. Er beschäftigt sich seit Jahren schwerpunktmäßig mit den Themen Krankenhausfinanzierung und Krankenhausplanung.
- Zahlen aus Destatis Grunddaten der Krankenhäuser 2023 und 1991 ↩︎
- Standortdefinition: Entfernung mehr als 2000 m ↩︎
- Definition: durchschnittliche Fahrtzeiten überschreiten »für einen erheblichen Teil der Einwohner des Einzugsgebiets« in Allgemeine Innere Medizin und Allgemeine Chirurgie 30 Minuten, bei den übrigen Leistungsgruppen 40 Minuten ↩︎
- Die Ermächtigung muss im hausärztlichen Bereich erteilt werden, im fachärztlichen Bereich, wenn keine Zulassungsbeschränkung besteht. ↩︎
- Die variablen Sachkosten sind ein erheblicher Teil der Gesamtkosten. Bei einer Blinddarmentfernung sind es ca. 14%, bei einem künstlichen Kniegelenk ca. 30%. ↩︎
- Die Fallschwere entspricht der Höhe des jeweiligen Relativgewichts ↩︎