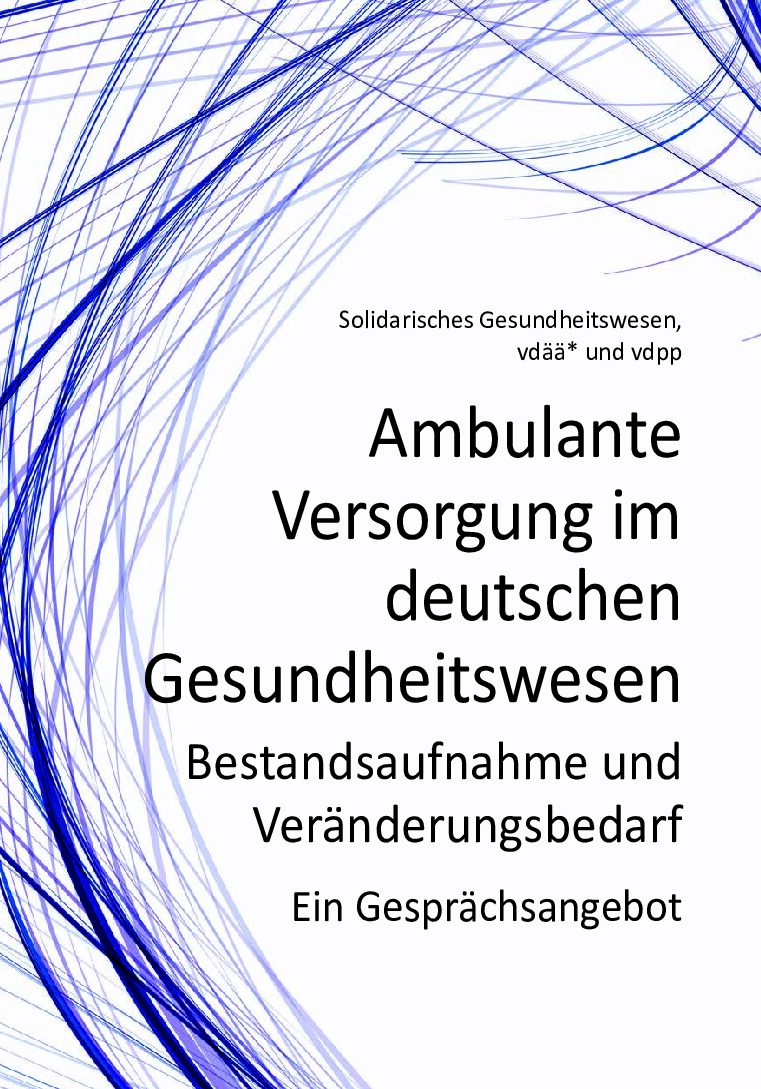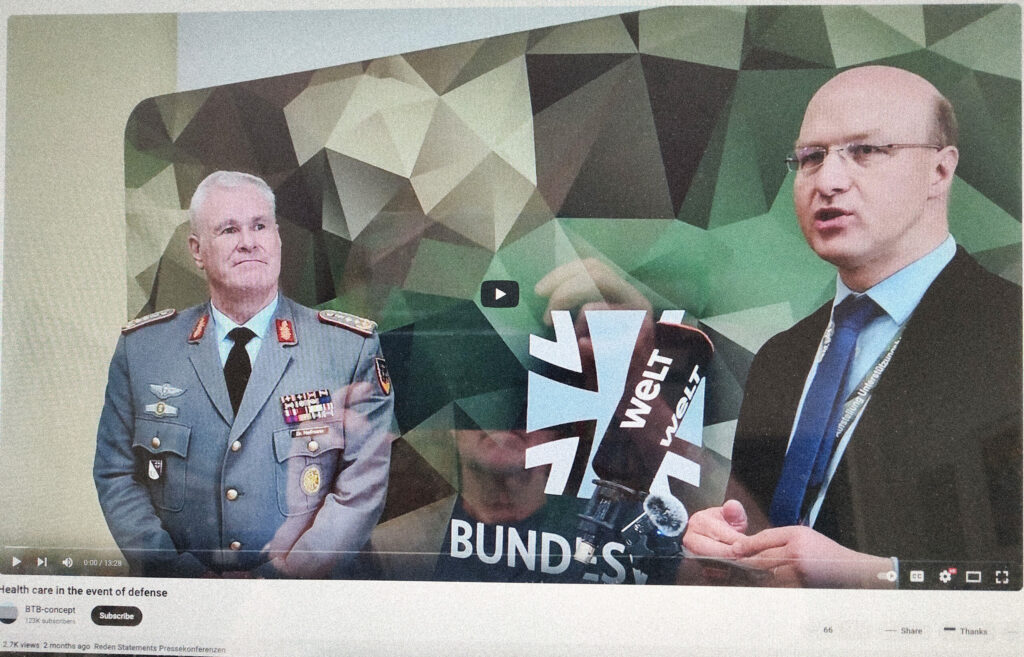Ambulante Versorgung im deutschen Gesundheitswesen
Bestandsaufnahme und Veränderungsbedarf. Ein Gesprächsangebot – Download hier
Einleitung
Die Gestaltung und Organisation der ambulanten Gesundheitsversorgung als eine bedarfsgerechte, vernünftige Struktur der Daseinsvorsorge ist in Deutschland gescheitert. Die Selbstverwaltung der ambulant tätigen Ärzt*innen kann den ihr übertragenen Versorgungsauftrag immer weniger und immer schlechter erfüllen, denn sie ist nicht in der Lage, die Unterversorgung in armen Stadtteilen vieler großer Städte und in Teilen des ländlichen Raums zu verhindern. Sie ist nicht in der Lage, die ambulante Medizin so zu steuern, dass die gesetzlich versicherten Patient*innen in angemessener Zeit, in zumutbarer Entfernung und mit vertretbarem Aufwand die individuell angezeigte Behandlung erhalten. Nach wie vor bestimmen der Versicherungsstatus (gesetzlich/privat), der Wohnort und die eigenen Ressourcen darüber, ob ein guter Zugang zur ambulanten Versorgung besteht. Besonders Menschen in strukturschwachen ländlichen und städtischen Räumen erleben allen theoretischen Versorgungszahlen zum Trotz einen massiven Mangel an realen Behandlungsangeboten. Zusätzlich werden für Menschen mit alters‑, behinderungs- oder krankheitsbedingten Beeinträchtigungen sowie für Menschen mit mangelhaften Deutschkenntnissen massive Barrieren aufgebaut. Noch immer besteht die anachronistische Zwei-Klassen-Medizin zwischen gesetzlich und privat Versicherten mit erheblichen, spezifischen Benachteiligungen auf beiden Seiten.
Die ambulante medizinische Versorgung hierzulande ist dringend reform-bedürftig. Das sehen inzwischen nicht nur linke Patient*innen, Ärzt*innen und Gesundheitspolitiker*innen so, sondern das ist seit einiger Zeit auch im gesundheitspolitischen Mainstream angekommen. Dass die Sektorentrennung sinnwidrig und für eine gute Versorgung kontraproduktiv ist, sagen inzwischen Viele. Dass Allgemein‑, Fach- und Psychotherapiepraxen im Kleinunternehmertum Fehlkonstruktionen sind, sagen Mitglieder des Vereins demokratischer Ärzt*innen (vdää*), seit es ihn gibt. Dass sie »falsche Anreize setzen«, kann man inzwischen auch in anderen Kreisen vernehmen. Die Schlüsse, die daraus gezogen werden, sind aber durchaus unterschiedlich.
Was Sie hier in Händen halten, ist das Resultat der Arbeit des Arbeitskreises Ambulante Versorgung des vdää*, zu dem aber nicht nur Ärzt*innen, sondern auch Pharmazeut*innen, Sozialwissenschaftler*innen, Patientenberater*innen und Menschen aus anderen Berufsgruppen gehören. Seit 2018 diskutieren wir darüber, wie wir uns eine bessere ambulante Versorgung vorstellen und wie man das Gesundheitswesen insgesamt verändern müsste, um diese zu erreichen. In dem Prozess der Diskussion und Konzeptionierung hatten wir allerdings gehofft, dass wir noch mehr Menschen aus unterschiedlichen Gesundheitsberufen für die Mitarbeit an dem Papier gewinnen können. Unsere Idealvorstellung war selbst die eines multiprofessionell arbeitenden Kollektivs, idealerweise mit Vertreter*innen von Zusammenschlüssen anderer Berufe (ähnlich wie vdää* und vdpp). Das ist uns nicht stabil gelungen, aber wir hoffen nun, mit dieser Publikation, diesem Diskussionsangebot einen neuen Anlauf machen zu können.
Nicht zufällig hat das konstituierende Treffen dieses Kreises (genau genommen war es die Neu-Konstituierung des AK, der eine Zeit lang geruht hatte) in Hamburg stattgefunden. Dort gibt es seit 2016 die Poliklinik Veddel, betrieben von einem Kollektiv, das die gleichen Fragen diskutiert – und mit der Veränderung der Versorgung schon praktisch begonnen hat.
Geschichte und Ziel
Wir hatten uns zum einen zum Ziel gesetzt, eine Bestandsaufnahme unserer Kritik an den herrschenden Zuständen im ambulanten Sektor zu machen. Zum anderen wollten wir uns auf Kriterien und auf zentrale Momente eines besseren Modells verständigen. Nicht nur, weil die unterschiedlichen Kapitel von unterschiedlichen Menschen geschrieben wurden, kam dabei kein Modell »aus einem Guss« heraus, das völlig konsistent auf alle zentralen Fragen weitgehend widerspruchsfreie Antworten gibt, sondern auch, weil wir uns in manchen Fragen nicht einig, in anderen Fragen zusammen nicht sicher sind, wie bestimmte Probleme konkret angegangen werden müssten.
Was wir hier zusammengestellt haben, ist also ein Zwischenergebnis als Diskussionsangebot. Es ist unsere Einladung an Sie und Euch, die praktisch tätigen Gesundheitsprofessionellen und Expert*innen, die Nutzer*innen und Patient*innen im Gesundheitswesen, mit uns ins Gespräch zu kommen, wie es besser sein könnte und wie wir dorthin kommen. Die einzelnen Texte gehen damit auf ihre je eigene Weise um.
An Patient*innen orientiert
Als Auftakt dient ein Kapitel aus und zur Patient*innenperspektive (Kapitel 2). Und dieser Einstieg ist auch Programm: Da das westdeutsche Gesundheitswesen historisch stark nach den Bedürfnissen (die sich als ökonomische Interessen konkretisierten) der Leistungserbringer*innen organisiert wurde und dies zu ungerechten Strukturen geführt hat, wollen wir versuchen, eine Versorgungsstruktur zu entwickeln, die sich an den Bedarfen der Patient*innen orientiert. Wie sollten die Strukturen aussehen und aufeinander aufgebaut sein, damit ein*e Patient*in möglichst niedrigschwellig an die für ihre Beschwerden richtige Stelle kommt und dort gut versorgt wird und ggf. er oder sie dann sachgerecht und durchschaubar weitergeleitet wird in die entsprechenden fachärztlichen Strukturen bis hin zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus? Wie sollte das Zusammenspiel von Ärzt*innen mit anderer Gesundheitsprofessionellen in diesen Strukturen sein, wie das Verhältnis der Krankenkassen zu den Leistungserbringer*innen und den Patient*innen, damit Letztere gut und möglichst ihren Bedürfnissen und Bedarfen gemäß versorgt werden? Wie könnten die Gesundheitsstrukturen besser im Stadtteil, im Dorf oder Landkreis, im Kiez verankert sein, so dass sie zu den sozialen Verhältnissen vor Ort passen und ihnen nicht ignorant oder völlig fremdartig gegenüberstehen?
Primärversorgung
Die Kapitel 3–7 beschäftigen sich mit unseren Vorstellungen einer sektorübergreifenden bzw. sektorfreien Primärversorgung. Im Kapitel »3. Sektorenfreie Gesundheitszentren« werden zunächst die Anforderungen an eine gute Primärversorgung diskutiert und ausgeführt, welche Strukturen dafür hilfreich wären. Zur wohnortnahen Primärversorgung gehört idealerweise eine Anlaufstelle als Türöffner (im angelsächsischen spricht man vom Dooropener), die zum richtigen Behandlungszweig führt. Es gehört zur Organisation, dass die Prozesse partizipativ, interprofessionell und interdisziplinär organisiert sind.
Mit dem letztgenenannten setzt sich das Kapitel »4. Multiprofessionelles Arbeiten und die Arbeitsteilung zwischen den Gesundheitsberufen« auseinander. Dass wir diesem so besonders viel Aufmerksamkeit widmen, ist der extremen Fragmentierung des deutschen Gesundheitswesens geschuldet. Die Erfahrung der in diesem fragmentierten System Arbeitenden ist, dass besonders sozial benachteiligte oder multimorbide oder ältere Patient*innen größte Probleme haben, sich darin zurecht zu finden. Multiprofessionelle Teams unter einem Dach führen in anderen Ländern zu mehr Patient*innensicherheit und ‑zufriedenheit. Aber die hier vorgeschlagenen Veränderungen sind innerhalb der bestehenden Strukturen nicht umzusetzen; sie brauchen Veränderungen, die in den folgenden Kapiteln vorgestellt werden.
Kapitel 5 widmet sich der Konkretisierung eine Vorstellung von ambulanter Primärversorgung, Kapitel 6 stellt einige Beispiele schon existierender oder im Aufbau befindlicher Primärversorgungszentren vor. Diese aus gemeinnützigen Initiativen entstandenen Polikliniken sind noch Pilotprojekte zum allgemeinen Beweis der Umsetzbarkeit solidarischer und demokratischer Primärversorgungszentren.
Aber für eine reale gesellschaftliche Verankerung und eine dauerhafte und flächendeckende Etablierung solcher Formen braucht es grundsätzliche Veränderungen auch der gesetzlichen Rahmenbedingungen des ambulanten Sektors. Welche Art Trägerschaft von Primärversorgungszentren wir favorisieren, muss noch weiter diskutiert werden. Für die Vergesellschaftung des ambulanten Sektors stellt sich, dies diskutiert der Kasten im Kapitel 5, die Frage der konkreten Ausgestaltung und des praktischen Demokratieverständnisses. Eine tatsächliche Transformationsperspektive ergibt sich nur, wenn das Konzept solidarischer und demokratischer Primärversorgungszentren das Nischendasein überwindet und auf eine breite Verankerung in der ambulanten Versorgung hinarbeitet. Können Gesundheitszentren in kommunaler Trägerschaft in diesem Sinn eine richtige Forderung sein? Aber wie werden sie tatsächlich demokratisiert? Wie nachhaltig abgesichert?
Über diese Fragen konnten wir noch keine Einigkeit erzielen, wir haben es deshalb vorgezogen, unsere Fragen und gegenseitigen Kritiken offenzulegen und den Leser*innen nachvollziehbar zu machen. Im Kapitel 7 »Primärversorgung in den Kommunen« finden sich deshalb am Ende einige dieser Fragen, die im weiteren Diskussionsprozess beantwortet und evtl. entschieden werden müssen.
Weiter geht es um die Eigentumsverhältnisse (Kapitel 8), die Bedarfsplanung (Kapitel 9) und die Finanzierungslogiken und ihre Implikationen (Kapitel 10). Diese Fragen sind nicht zuletzt auch entscheidend für die Gemeinwohl- und Patientenorientierung der Versorgung. Um zu verstehen, warum die Strukturen bezüglich dieser Fragen so verhärtet sind, ist ein Blick in die Historie nützlich. Es zeigt sich, dass die Themen zusammengehören; die Finanzierung ist bestimmt durch die Eigentumsverhältnisse und die Interessen der Privateigentümer*innen. Will man die Finanzierung ändern, greift man die Eigentumsordnung (und die Eigentümer*innen) an, will man die Eigentumsordnung ändern, muss / kann man auch die Finanzierung ändern. Will man eine rationale, sach- und bedarfsgerechte Finanzierung, braucht man einen Überblick über den Bedarf, also auch eine sinnvolle Bedarfsermittlung und eine – möglichst demokratische – Planung der bedarfsgerechten Strukturen. Und all dies müsste sektorenübergreifend gedacht und organisiert sein.
Von alledem sind wir weit weg in Deutschland. Beim Verfassen der Texte für die Broschüre diskutierten wir immer wieder die Frage, ob es für unsere Vorstellungen im – sich verändernden – bestehenden System Anknüpfungspunkte gibt, oder ob wir uns von diesem lösen müssen, um zu einem konsistenten »Wunschmodell« zu kommen. Wie aber stellen wir uns dann den Weg dorthin vor?
Im letzten Kapitel »Arztpraxen und MVZ im Fokus von Private-Equity-Gesellschaften « schauen wir uns deshalb an, in welche Richtung sich der ambulante Sektor aktuell auch entwickelt, wenn die Gesellschaft diesem Prozess nicht Einhalt gebietet. Mit der Möglichkeit, MVZ auch nur noch mit einer Fachrichtung gründen zu können, eröffnet sich für anlagesuchendes Kapital im ambulanten Sektor ein neuer Markt und eine Form der kapitalistischen Organisation der medizinischen Versorgung, die unseren Vorstellungen diametral entgegengesetzt ist und die wir entschieden bekämpfen.
Wir sehen: Die Zeit drängt. Die Debatten werden geprägt von großem Reformdruck, bei ebenso großer Besitzstandswahrung auf der einen Seite und marktradikalen Vorstellungen auf der anderen Seite. Die Regierungen der letzten Jahre haben Reparaturpolitik betrieben, teilweise die schlimmsten Auswirkungen abgemildert, zugleich aber im Lobbyinteresse an zentralen Fehlsteuerungen festgehalten. Es fehlte bei allen Regierungsbeteiligten der vergangenen zwanzig Jahre der politische Wille, die Gesundheitsversorgung in Umsetzung des Verfassungsauftrags als staatliche Aufgabe umzusetzen. Das dysfunktionale Durch- und Nebeneinander von Regulierungsversuchen und kapitalistischer Marktlogik muss zugunsten einer stimmigen Neukonzeption in demokratischer Verantwortung und mit gemeinnützigen Strukturen überwunden werden.
Die inhaltlichen Kapitel dieses Textes sind im Herbst 2021 fertiggestellt worden. Neuere Entwicklungen, auch mit der Koalition aus SPD / GRÜNEN / FDP konnten wir nicht mehr berücksichtigen. Wir sehen dieses Papier – wie ober geschrieben – nicht als abschließend an, sondern verstehen es als Einladung, weiter zu diskutieren, zu ergänzen und zu konkretisieren. Orte und Termine für solche Diskussionen werden wir auf der Homepage des vdää* bekannt geben.
Michael Janßen / Udo Puteanus / Nadja Rakowitz / Stefan Schoppengerd / Florian Schulze / Bernhard Winter – 28. April 2022
(Die Erstellung der Broschüre wurde inhaltlich, personell und finanziell vom Solidarischen Gesundheitswesen e.V. unterstützt.)