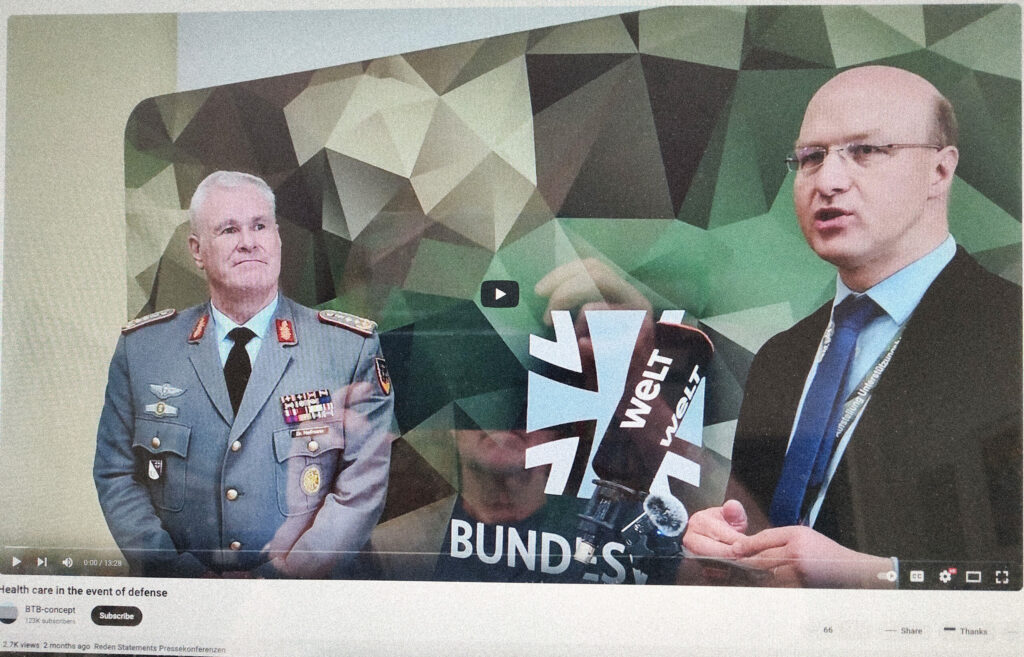Bewertung der 5. Stellungnahme der Regierungskommission
vom Bündnis Krankenhaus statt Fabrik
Die fünfte Stellungnahme der „Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung“ zum Thema: „Verbesserung von Qualität und Sicherheit der Gesundheitsversorgung. Potenzialanalyse anhand exemplarischer Erkrankungen“[1] vom 22. Juni 2023 geht von der These aus, dass Deutschland bei der Behandlungsqualität, etwa bei den vermeidbaren sowie behandelbaren Todesursachen, im OECD-Vergleich nur im Mittelfeld, liege.
Sie will wissenschaftlich belegen, dass man durch die Umsetzung der von ihr vorgeschlagenen Maßnahmen potentiell über elf Krebsarten hinweg über 20.000 Lebensjahren jährlich gewinnen, das Versterben innerhalb des ersten Jahres nach dem Schlaganfall um knapp 5.000 Fälle reduzieren und hunderte Revisionsoperationen bei Hüft- bzw. Knie-TEP-Implantationen vermeiden könne. Die Messlatte ist also hoch gelegt, die Wichtigkeit für die Gesundheit der Bevölkerung immens. Wir haben uns die Argumentation und die zugrundeliegenden Studien genauer angeschaut und kommen zu anderen Schlüssen. Besonders die behauptete Wissenschaftlichkeit der Argumentation und damit die Unabhängigkeit der Kommission ist dabei fragwürdig. Das Ziel, Gründe für die Schließung kleiner Krankenhäuser zu präsentieren, dominiert erkennbar die Argumentation.
Ein Teil unserer Einwände wird bestätigt und verstärkt durch die Studie „Kritische Würdigung der Analyse der Regierungskommission zur Verbesserung von Qualität und Sicherheit der Gesundheitsversorgung – Potentialanalyse anhand exemplarischer Erkrankungen“[2] von Prof. Erika Raab, die detailliert die „Problemzonen“ der Stellungnahme der Regierungskommission beleuchtet.
Allgemeines:
- Die Stellungnahme unterscheidet sich dadurch von den bisherigen und angekündigten Stellungnahmen, dass sie zu keinem speziellen Thema der Versorgung Stellung nimmt, sondern Argumente für die 3. Stellungnahme nachschiebt.
- Es ist offensichtlich, dass es sich um eine Auftragsarbeit für Bundesgesundheitsminister Lauterbach handelt, der in der Öffentlichkeit („Schließungswelle“) und in den Verhandlungen mit den Ländern unter Druck gekommen ist. Große Teile der Kommissionsvorschläge sind durch die Eckpunktepapiere abgeräumt. Es handelt sich von Seiten der Kommission also auch um einen Wiederbelebungsversuch ihrer Vorschläge.
- Den Grundthesen der Stellungnahme (bessere Ergebnisse der Krebsbehandlung in zertifizierten Zentren, bessere Ergebnisse der Schlaganfallbehandlung in Stroke-Units, bessere Ergebnisse des Gelenkersatzes bei hohen Zahlen) kann im Grundsatz zugestimmt werden und sie werden wohl auch von niemandem bezweifelt.
Allerdings kann daraus nicht schlüssig die Notwendigkeit der Schließung/Umwandlung kleiner Krankenhäuser abgeleitet werden. Es gibt Schlaganfallnetzwerke, bei denen sich auch kleinere Krankenhäuser beteiligen und auch onkologische Zentren werden oft in Kooperation mit kleineren Häusern betrieben, jeweils mit gutem Outcome für die Patient*innen - Handelt es sich in diesen beiden Fällen um qualitative Festlegungen, so wird beim Gelenkersatz auf die reine Fallzahl abgestellt. Es spricht einiges dafür, dass auch hier die Grundthese (bessere Ergebnisse in Zentren mit größeren Fallzahlen) stimmt, was zu einer Beschränkung des Versorgungsauftrages für kleinere Häuser führen müsste, aber ebenfalls nicht zu ihrer Schließung/Umwandlung. Kleinere Häuser in ländlichen Gegenden haben einen ganz anderen Versorgungsauftrag: die Grund- und Notfallversorgung der jeweiligen Bevölkerung im Versorgungsgebiet. Gelenkersatz gehört nicht hierzu. Anders sieht dies bei kleinen Krankenhäusern in Ballungsgebieten aus. Sie können verzichtbar sein, allerdings nur, wenn die Kapazitäten der anderen Häuser erhöht werden.
- Sowieso sind 2 der 3 untersuchten Entitäten zeitunkritisch (Krebsbehandlung, Gelenkersatz) und die Berechnung der Verlängerung der Fahrtzeiten ist eigentlich irrelevant. Dennoch findet hier ein interessantes Verwirrspiel mit statistischen Daten statt. Die Kommission kommt bei allen 3 besprochenen Behandlungsanlässen zum Ergebnis, dass im Schnitt keine oder nur eine unwesentliche Verlängerung der Fahrtzeiten bei ihren Zentralisierungsvorschlägen stattfinden würde. Das ist Augenwischerei. Bekanntlich zeichnen sich ländliche Bereiche durch eine geringere Bevölkerungszahl als Großstadtbereich aus. Der Anteil ihrer Fahrtzeit geht also viel schwächer in eine Durchschnittsbildung ein. Ein Beispiel: In einem ländlichen Bereich leben 100.000 Menschen, die durchschnittlich eine Fahrtzeit von 30 Minuten zum nächsten Versorger haben. In großstädtischen Gebieten leben 900.000 Menschen mit einer Fahrtzeit von 15 Minuten. Schließt der ländliche Versorger und die Fahrtzeiten erhöhen sich auf 60 Minuten, dann ändert sich die durchschnittliche Fahrtzeit aller nur von 16,5 Min. auf 19,5 Min. Hier einen Durchschnitt zu bilden, verbietet sich bei seriöser Argumentationsweise. Die Verschlechterung der Situation der Bevölkerung in ländlichen Gebieten wird weggerechnet.
- Schlaganfälle sind zeitkritisch. Deshalb ist die Variante „nur Behandlung in großen überregionalen Zentren“ nicht die einzige Lösung und je nach Entfernung evtl. auch nicht die beste. Die angesprochenen Netzwerke und vor allem die von uns geforderten ambulanten Versorgungszentren der Krankenhäuser sind eine bessere Lösung. Sie muss mit einer Ausweiterung der Notarztstandorte und der Hubschrauber-Stationierungen verbunden werden.
- Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass der behauptete Zusammenhang zwischen Outcome und Spezialisierungsgrad der behandelnden Krankenhäuser als einzige Kausalität für die unterschiedlichen Behandlungsergebnisse dargestellt wird. Welchen Stellenwert für unterschiedliche Behandlungsergebnisse die finanziellen Anreize durch das DRG-System haben oder die Personalausstattung der KH oder die Unterschiede im Umgang mit Fehlern oder die Art und Weise der beruflichen Ausbildung in den Gesundheitsberufen oder die unterschiedliche Organisation der ambulanten und stationären Gesundheitsversorgung in verschiedenen zum Vergleich herangezogenen Ländern, das alles wird als mögliche zusätzliche oder konkurrierende Ursachen für den beobachteten Zusammenhang nicht betrachtet. Wissenschaftlich wäre eine derart umfassende Betrachtung aber geboten.
- Schließungen kleiner Krankenhäuser führen zu einem höheren Druck auf die verbleibenden großen Häuser: Wenn jeder Verdacht auf einen Herzinfarkt oder Schlaganfall nur in die entsprechend spezialisierten Kliniken gebracht werden darf, ohne dass andere der Spezialisierung nicht bedürftige Differentialdiagnosen ausgeschlossen wurden, werden die Versorgungskapazitäten der spezialisierten Abteilungen mit großer Sicherheit überschritten.
- Ein weiteres grundsätzliches Problem von Messungen der Ergebnisqualität kommt hinzu: Die Frage der Verursachung lässt sich nicht eindeutig zuordnen. Ist das Behandlungsergebnis Folge der Krankenhausbehandlung, der Vor- und/oder Nachbehandlung durch andere oder ist es Folge des Krankheitsbildes selbst bzw. des Verhaltens des Patienten oder der Patient*in? Hier gilt: Je länger der Beobachtungszeitraum (z.B. Einjahresüberlebenszeit), umso unsicherer das Ergebnis. Auch diese Problematik blendet die Kommission völlig aus.
- Auch wenn wir also im Grundsatz den Thesen nicht widersprechen (allerdings sehr vehement der Intention), ist es dennoch interessant, inwieweit die vorgelegten Studien und „Belege“ und ihre Interpretation durch die Regierungskommission wissenschaftlich valide diese Thesen erhärten. Hieran gibt es Zweifel.
Fallbeispiel 1: Krebsbehandlung:
Den Betrachtungen der Kommission liegt die Studie „Wirksamkeit der Versorgung in onkologischen Zentren“ (WiZen, Förderkennzeichen 01VSF17020[3]) gefördert vom Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) zugrunde. Sie betrachtet anhand von AOK-Routinedaten Patient*innen der Jahre 2007 bis 2017 mit einer von 11 Krebsdiagnosen, wobei die Patient*innen der ersten beiden Jahre ausgeschlossen wurden, um nicht frühere Erkrankungen mitzurechnen. Die Studie hat relativ präzise Einschluss- und Ausschlusskriterien (S. 15 Ergebnisbericht).
Die Definition der Krebs-Erstbehandlung (Erstoperation und nur, wenn keine Operation durchgeführt wurde, die stationäre Erstbehandlung mit der entsprechenden Hauptdiagnose) entscheidet über die Frage, ob eine Zentrumsbehandlung oder nicht vorliegt. Patient*innen, die während ihrer Behandlung von einem Krebszentrum in ein anderes Krankenhaus wechselten und umgekehrt, wurden ausgeschlossen.
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Behandlung in einem Krebszentrum Vorteile hat. Allerdings ist die Interpretation der Ergebnisse sehr vorsichtig. Hier einige Beispiele:
„Ein systematisches Review, welches die Effekte von Behandlungen in zertifizierten Zentren analysierte, konnte keine eindeutigen Schlüsse bezüglich der Versorgung von Patient:innen und der Wirksamkeit der Behandlung ziehen (Keinki et al., 2016).“ (S. 7)
„Insgesamt sollte eine kausale Interpretation der Ergebnisse nur mit Vorsicht abgeleitet werden.“ (S. 13)
„Der Überlebensvorteil für Patient:innen, die in zertifizierten Zentren behandelt wurden, fällt für die verschiedenen Entitäten unterschiedlich aus. Ein solcher Vorteil wurde – statistisch signifikant (…) – für das Kolonkarzinom, das Mammakarzinom, das Zervixkarzinom, das Prostatakarzinom und neuroonkologische Tumoren beobachtet.“ (S. 41) – also für 5 von 11!
„Unser Datensatz lässt eine kausale Interpretation der Ergebnisse nicht zu: da der Status ‚Zertifizierung‘ ein komplexes Gefüge von Interventionen auf Krankenhausebene umfasst, die schwer zu quantifizieren sind, unterliegen die meisten, wenn nicht alle Studien, die auf die Evaluation der Zertifizierung abzielen, dieser Einschränkung. Außerdem war eine Randomisierung der Kohorte aufgrund der Struktur des Zertifizierungssystems und der Verwendung von Sekundärdaten / Krebsregisterdaten nicht möglich. Auf der Patientenebene gab es keinerlei Informationen über den sozioökonomischen Status.“ (S. 41f.)
Was angesichts der Diskussion um die Schließung kleiner Krankenhäuser auch noch interessant ist: „Die stratifizierten Analysen ergaben für diese Entitäten somit keine Evidenz für Modifikationen des Zentrumseffektes durch die Größe des behandelnden Krankenhauses. (S. 30)
Die Regierungskommission hat nun die Ergebnisse der Studie auf das Jahr 2021 übertragen und mit der aktuellen Patient*innenzahl und Zahl der Zentren/Nicht-Zentren hochgerechnet. Dabei wird als Zentrum nur gewertet, wenn eine Zertifizierung der Deutschen Krebsgesellschaf (DKG) vorlag (Stellungnahme, S. 14). Es gibt aber etliche weitere Zertifizierungsverfahren und ‑vorgaben auf Landesebene und durch den G‑BA, die gleichwertig sind, aber von der Regierungskommission nicht gerechnet werden. Weiterhin gibt es zwischenzeitlich in vielen Ländern (z.T. auf Basis von Festlegungen im jeweiligen Landeskrankenhausplan) Zusammenschlüsse von Kliniken, die zusammen mit einem Kompetenzzentrum eine gemeinsame Versorgung von Krebspatient*innen betreiben. Auch sie werden nicht als Zentrum gewertet.[4]
Auch in der Behandlung von Krebs hat sich seit den Jahren 2007 bis 2017 einiges geändert (z.B. ambulante Chemotherapien), sodass erhebliche Bedenken bestehen, ob die Ausgangsdaten der Berechnung der Kommission noch valide sind. Die Verwendung der Abrechnungsdaten der Krankenkassen wirft weitere Zweifel auf: In ihnen sind wichtige Informationen zum Tumorstadium nicht enthalten, sodass eine unterschiedliche Zusammensetzung der ursprünglichen Grundgesamtheiten nicht ausgeschlossen werden kann.
Zur Frage des Einschlusses/Ausschlusses von Patient*innen und Zentren wird – im Gegensatz zur Studie – keinerlei Aussage gemacht. Wird in der Studie die Erstbehandlung klar als die Erst-OP ausgewiesen, spricht die Kommission nur von Erstbehandlung. Damit können Patient*innen, die zuerst nicht in einem Zentrum behandelt wurden, deren Operation aber in einem Zentrum stattfand, falsch gewertet werden. Dasselbe gilt für den umgekehrten Fall. Ausschlüsse von Patient*innen und Krankenhäusern aufgrund des Verlaufs der Behandlungen bzw. der Entwicklung des Zentrenstatus sind bei dieser einmaligen Auswertung sowieso nicht möglich. Es kann sich also um eine ganz andere Grundgesamtheit handeln und damit ist natürlich die Übertragung der Ergebnisse nicht korrekt.
Die Beschränkungen des Datenjahres 2021 durch Corona (Verschiebung von Eingriffen, Angst von Patient*innen vor Krankenhausaufenthalten) werden nicht betrachtet. Auch die fehlende Berücksichtigung von Patient*innenverfügungen und gewollten palliativen Versorgungen (einhergehend mit einer Versorgung in einer kleineren und nicht spezialisierten Klinik) verfälscht die Ergebnisse.
Einen Überlebensvorteil auch dann anzunehmen und zu berechnen, wenn eine nicht zertifizierte Klinik lediglich „an der Versorgung beteiligt“ war (s. Tabelle S. 13 in der Stellungnahme der Kommission), also z.B. die Diagnose gestellt oder eine präoperative Chemotherapie durchgeführt hat, die OP aber in einer zertifizierten Klinik stattfand, entspricht nicht den Definitionen der WiZen-Studie.
Wie viele „primäre Resektionen (Erst-OPs)“ im Jahr 2021 in nichtzertifizierten Kliniken stattfanden, hat die Regierungskommission nicht dargelegt und nicht zur Berechnungsgrundlage gemacht.
Das errechnete „Qualitätspotential“ von 20.404 Lebensjahren schätzt sie auf Grund der Erweiterung der Definition der „Behandlung in nichtzertifizierter Klinik“ auf jede Erstbehandlung und die gesamte Versorgung zu hoch ein. Die politische Wirkung ihrer Fehlberechnung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.
All das ficht die Kommission nicht an. Sie kommt zu dem vermeintlich klaren Ergebnis: „Pro Jahr könnten für die einzelnen Krebsarten zwischen 665 (Zervixkarzinom) und 4.873 (Kolonkarzinom) Lebensjahre durch die Konzentration der Erstbehandlung ausschließlich auf zertifizierte Kliniken gerettet werden.“ (S. 15) Damit zieht sie genau die kausalen Schlüsse, die die Studie ablehnt und die bei dieser Art von statistischen Auswertungen überhaupt nicht möglich sind.
Diese Zahlen sollen beeindrucken und tatsächlich hat es die Kommission mit dieser Rechnung geschafft, faktisch auf alle Titelseiten wichtiger Medien zu kommen. Dahinter steht aber wieder ein Rechenkunststück. Die Berechnung der Überlebensjahre ist im Wesentlichen geprägt durch die hohe Zahl von Fällen, denn bezogen auf den einzelnen Patient*innen sieht das alles ganz anders aus: „Sie beträgt zwischen 1 Monat (Lungenkrebs) und 5 Monaten (Zervixkarzinom) Lebenszeit pro erkrankter Person“ (S. 14). Diese Zahlen hätten sicher nicht für Schlagzeilen gesorgt.
Um das nochmals zu betonen: Es geht uns bei unserer Bewertung nicht darum, Behandlungsvorteile von Zentren zu leugnen. Es geht um die unlautere Vorgehensweise und die unlauteren Absichten, die hinter dieser Kommissionsstellungnahmen stehen.
Fallbeispiel 2: Schlaganfall
Den Betrachtungen der Kommission liegt die Studie „Ergebnisse QUAalitätsgesicherter SCHlaganfallversorgung: Hessen im Vergleich zum übrigen Bundesgebiet“ (Quasch Förderkennzeichen 01VSF18041[5]) gefördert vom G‑BA zugrunde. Sie betrachtet anhand von AOK-Routinedaten Patient*innen der Jahre 2007 bis 2017 mit Schlaganfall. Auch diese Studie benennt klar ihre Limitationen: „Als Beobachtungsstudie können die Ergebnisse naturgemäß nicht kausal interpretiert werden. (…) Die Studie beschränkt sich auf die Sterblichkeit als Aspekt der Ergebnisqualität, der mit Routinedaten abgebildet werden kann, aber zum Teil kritisch hinterfragt wird. Andere relevante Ergebnisse wie beispielsweise die Funktionalität nach Schlaganfall, wie sie mit der International Classification of Functioning, Disability and Health abgebildet wird, werden nicht berichtet, da hierzu keine Routinedaten vorliegen. Diese Limitation gilt auch für die nur auf Routinedaten beruhende Risikoadjustierung, womit möglicherweise relevante Einflussfaktoren wie der Schlaganfallschweregrad bei Aufnahme nicht berücksichtigt werden.“ (Ergebnisbericht S. 24f.)
Hingegen schreibt die Regierungskommission (S. 22): „Ausgehend von den Unterschieden in der Einjahressterblichkeit laut der QUASCH-Studie zeigt Tabelle 6 das Potenzial zur Reduktion der Einjahressterblichkeit, wenn alle Patientinnen und Patienten in Stroke Units behandelt würden. (…) Insgesamt resultiert ein Potenzial vermiedener Einjahressterblichkeit von 4.969 Fällen.“
Die Problematik der Verwendung von Abrechnungsdaten der Krankenkassen, der Verwendung von alten Daten (ohne Berücksichtigung von Veränderungen in der Versorgungslandschaft und von Behandlungsfortschritten) ist dieselbe wie im Fallbeispiel 1 Krebsbehandlung (siehe dort). Die Rettungsdienstgesetze der Bundesländer verpflichten Notärzt*innen und Rettungsdienste dazu, Notfallpatient*innen in ein für die weitere Behandlung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Das ist im Falle des Schlaganfalls in der Regel ein Krankenhaus mit Stroke Unit. Hier als Beispiel der Wortlaut der Regelung des § 2 Abs. 2 des Rettungsgesetzes NRW: „(2) Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern.“[6]
Solche landesgesetzlichen Regelungen gewährleisten, dass alle Patient*innen mit Schlaganfall, bei denen eine kurative Behandlung angestrebt wird, also eine möglichst weitgehende Behebung der Ursachen und Folgen des Schlaganfalls, in eine Stroke Unit eingeliefert werden. Lediglich Patient*innen mit einer Patient*innenverfügung, die invasives Vorgehen und/oder intensivmedizinische Behandlung ausschließt, oder demente, multimorbide, nicht rehabilitationsfähige Menschen, bei denen lediglich eine palliative Behandlung angestrebt wird, werden auch in Krankenhäuser ohne Stroke Unit eingeliefert.
Das war z.B. im Land NRW im Krankenhausplan 2015 explizit geregelt: Im Anhang F zum Krankenhausplan „Grundlagen zur Anerkennung von Behandlungseinheiten zur Schlaganfallversorgung (Stroke Units) im Krankenhausplan Nordrhein-Westfalen“ hieß es dazu: „Indikationen für die Akutbehandlung außerhalb von Stroke Units sind weiterhin gegeben bei Patientinnen und Patienten mit schon länger bestehender, stabiler neurologischer Symptomatik und bei bereits bestehender Pflegebedürftigkeit und Multimorbidität. Daher wird die Aufnahme sämtlicher Schlaganfallpatientinnen und –patienten auf einer Stroke Unit nicht angestrebt.“[7] (Fett und unterstrichen im Original)
Dementsprechend müsste in Mortalitätsstatistiken, wie es auch die Arbeitsgemeinschaft Deutschsprachiger Schlaganfallregister (ADSR) in ihren „Qualitätsindikatoren/Kennzahlen 2021/2022/2023 (Stand 22.05.2023)“ empfiehlt, zwischen „Todesfällen bei Patienten mit Hirninfarkt“ und „Todesfällen bei Patienten mit Hirninfarkt (exkl. Patienten mit palliativer Zielsetzung)“ unterschieden werden. Das hat die Regierungskommission nicht getan.
Wenn die Schlaganfallpatient*innen, die nicht in Stroke Units behandelt werden, wie aus notärztlicher und Rettungsdiensterfahrung zu vermuten, weit überwiegend „Patienten mit palliativer Zielsetzung“ sind, dann überschätzt die Kommission das „Potential vermiedener Einjahressterblichkeit“ um ein Vielfaches.
Die in der Einleitung angesprochene Studie von Erika Raab macht auf einen weiteren Fehler der Bewertung der Regierungskommission aufmerksam (Studie, S. 75 ff.): Es wird nicht zwischen Patient*innen und Fällen unterschieden (ein*e Patient*in generiert bei mehrfachen Krankenhausaufnahmen mehrere Fälle). Außerdem gibt es gravierende Widersprüche zu den Sterbezahlen des statistischen Bundesamtes. Raab kommt zu dem Schluss: „Tatsächlich resultieren aus den 4.969 vermeidbaren Todesfällen in der Potentialanalyse der Regierungskommission auf den Menschen lediglich 1.468 „vermeidbare“ Todesfälle!“ (Studie, S. 96)
Fallbeispiel 3: Endoprothetik (künstlicher Gelenkersatz)
Die Regierungskommission zieht folgendes Fazit:
„Potenzial der Konzentration der Endoprothetik- Versorgung (künstlicher Gelenkersatz)
Wie Tabelle 10 zu entnehmen ist, können durch eine Konzentration der Endoprothetik-Versorgung relevante Qualitätsverbesserungen, gemessen an vermeidbaren Revisionseingriffen innerhalb des ersten Jahres und einer deutlichen Reduktion der Krankenhaussterblichkeit, erreicht werden. Bei der Interpretation ist zu beachten, dass ein tödlicher Ausgang bei einer geplanten, elektiven Operation eine schwerwiegende Komplikation ist. Die Vermeidung von über 150 Krankenhaussterbefällen pro Jahr wäre für eine geplante Operation am Bein eine hochrelevante Verbesserung der Versorgungsqualität.“
Die Kommission stützt sich u.a. auf das Endoprothesenregister Deutschland (EPRD): „Für die primäre Knie- und Hüft-TEP basiert die zugrunde liegende Studienevidenz auf bundesweiten Daten des Endoprothesenregisters Deutschland (EPRD) der Jahre 2012 bis 2019.“(S. 26)
Dem EPRD-Jahresbericht 2022[8] ist zu entnehmen, dass das Endoprothesenregister nicht nur geplante, also orthopädische Eingriffe aufführt, sondern auch unfallchirurgische Eingriffe: „Das EPRD erfasst neben geplanten Eingriffen auch Notfalleingriffe zur Versorgung hüftgelenknaher Femurfrakturen. Während bei geplanten bzw. elektiven Eingriffen im Regelfall eine Totalendoprothese eingesetzt wird, kommen bei unfallchirurgischen Eingriffen bei älteren Patient:innen häufiger Teilendoprothesen zum Einsatz.“ (EPRD-Jahresbericht 2022, S. 46)
Den Mortalitätsstatistiken der „Initiative Qualitätsmedizin“ (IQM) lässt sich entnehmen, dass es in ihren etwa 500 Mitgliedskrankenhäusern im Jahr 2022 bei orthopädischer Erstimplantation eines Hüftgelenks zu 84 Todesfällen bei 58.846 Operationen kam (0,14%). Beim unfallchirurgischen Hüftgelenksersatz (Erstimplantation bei hüftgelenksnahen Frakturen) kam es hingegen zu 1.278 Todesfällen bei 22.320 Eingriffen (5,7%). Die Sterblichkeitsrate bei unfallchirurgischen Eingriffen war also etwa 40-mal so hoch wie bei orthopädischen Eingriffen. Die Sterblichkeit bei „Hüft- oder Kniegelenksersatz bei Tumorerkrankung“ lag bei 6,9% (163 von 2.369).
Wer die Mortalität und das Ausmaß von Komplikationen beim Hüft- und Kniegelenksersatz beurteilen möchte, müsste mindestens zwischen geplanten orthopädischen Eingriffen, unfallchirurgischen Notfalleingriffen und tumorbedingten Eingriffen unterscheiden.
Die IQM-Daten zeigen, dass unfallchirurgische Eingriffe erfreulicherweise deutlich seltener erforderlich sind als orthopädische Eingriffe. Dadurch wird aber ein Vergleich anhand von Fallzahlen tendenziell zum Vergleich zwischen eher orthopädisch ausgerichteten Klinken (mit hohen Fallzahlen und sehr geringer Sterblichkeit) und eher unfallchirurgisch ausgerichteten Kliniken (mit niedrigeren Fallzahlen und deutlich höherer Sterblichkeit). Die Schlussfolgerungen, die die Kommission zieht, sind daraus nicht abzuleiten.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass die „reine“ Wissenschaft, die Lauterbach mit der Bildung der Kommission in die Politik einführen wollte, gar nicht so „rein“ ist. Mit dieser Stellungnahme liefert die Kommission wissenschaftlich unredliche Munition für den laufenden „kalten Strukturwandel“ durch Insolvenzen und die Politik der Schließung kleiner Krankenhäuser. Sie bestätigt damit wieder einmal, was mit der mehrheitlichen personellen Besetzung der Kommission bereits von Anfang an klar war: Das Ziel vieler Mitglieder der Kommission war es nie, eine sachgerechte, wissenschaftlich begründete Politikberatung zu machen, sondern dem Ziel der Durchsetzung einer neoliberalen Marktordnung im Krankenhauswesen zu dienen.
(11.08.2023
[1] https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Krankenhausreform/5_Stellungnahme_Potenzialanalyse_bf_Version_1.1.pdf
[2] Erika Raab: „Wenn die Wahrheit zwei Seiten hat. Kritische Würdigung der Analyse der Regierungskommission zur Verbesserung von Qualität und Sicherheit der Gesundheitsversorgung – Potentialanalyse anhand exemplarischer Erkrankungen, 2023, in: https://www.medizincontroller.de/dokumente/info/Interessante_Veroeffentlichungen/Gutachten_zur_Potentialanalyse_der_Regierungskommission_Raab_2023.pdf
[3] https://innovationsfonds.g‑ba.de/beschluesse/wizen-wirksamkeit-der-versorgung-in-onkologischen-zentren.111
[4] Vertiefend: Erika Raab: „Wenn die Wahrheit zwei Seiten hat“, a.a.O., S. 31 ff.
[5] https://innovationsfonds.g‑ba.de/beschluesse/quasch-ergebnisse-qualitaetsgesicherter-schlaganfallversorgung-hessen-im-vergleich-zum-uebrigen-bundesgebiet.62
[6] https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=4300&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=344704
[7] https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/20130725_krankenhausplan_nrw_2015.pdf
[8] https://www.eprd.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Publikationen/Berichte/Jahresbericht2022-Status5_2022-10–25_F.pdf