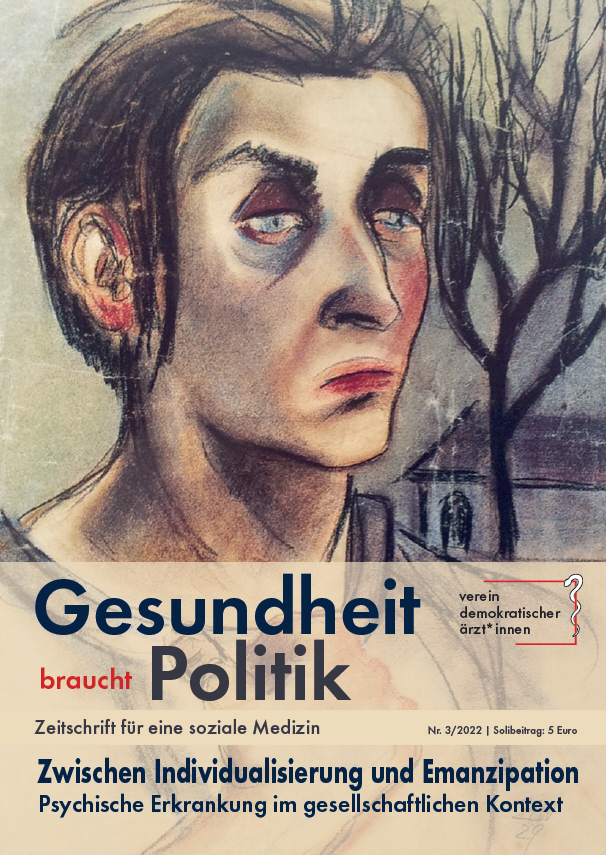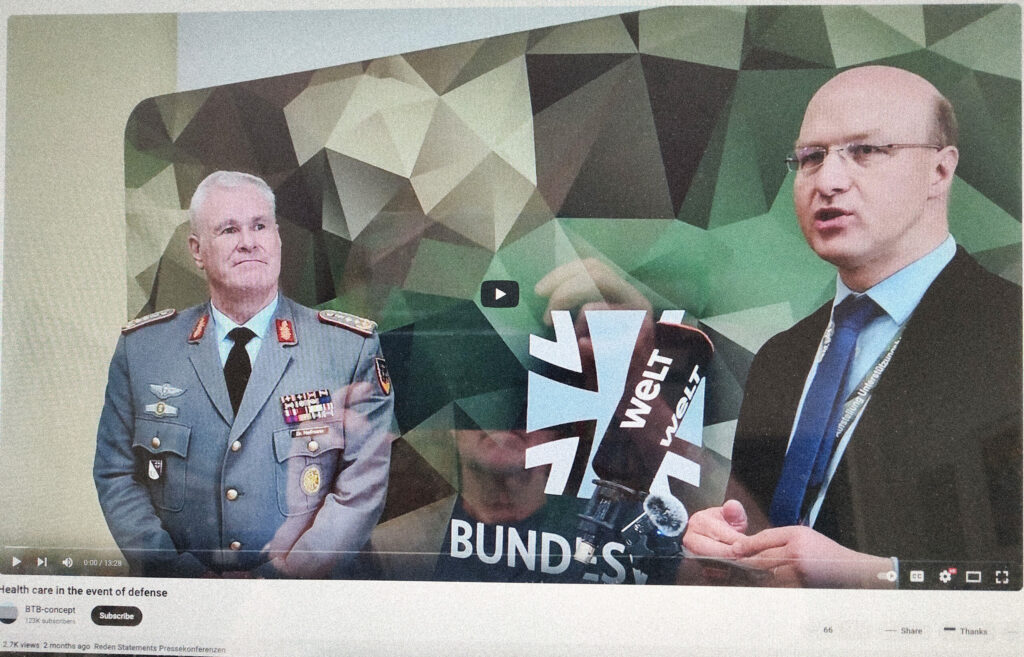Von Lukas Welz
Die Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag auf einen Paradigmenwechsel in der Migrations- und Flüchtlingspolitik geeinigt. Reformen und wirkliche Verbesserungen lassen aber noch auf sich warten.
| So viele Menschen wie noch nie sind derzeit auf der Flucht ins Ungewisse und verlassen ihre Heimat und ihre Lieben. Das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen geht von über 100 Millionen Menschen aus, die im Jahr 2022 auf der Flucht sind. Menschen fliehen vor Kriegen, Terror und Gewalt, vor Ausgrenzung und Diskriminierung, Verfolgung, Hunger und Armut – kurzum, einem Versagen staatlichen Schutzes und gesellschaftlicher Verantwortung für Menschen jedweder Identität. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Zahl der Vertriebenen nochmals erhöht, und auch durch die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan waren und sind weitere Menschen zur Flucht gezwungen. |
Auf den Fluchtrouten sind sie weiterer Gewalt und Abwehr ausgesetzt. Durch die Menschenrecht verletzende Politik der EU und ihrer Mitgliedsstaaten sterben Menschen vielfach bei dem Versuch, über das Mittelmeer oder den Balkan nach Europa zu gelangen und um Asyl zu bitten. Dabei haben Überlebende von Krieg, Folter und Verfolgung ein Recht auf Schutz, rechtlich bindend ist dies für Deutschland seit nunmehr 71 Jahren. Mit Unterzeichnung der Genfer Flüchtlingskonvention stehen geflüchteten Menschen universelle Rechte im Asyl zu.
Schutz von Geflüchteten in Deutschland?
Deutschland hat sich selbst in zahlreichen Verträgen und Übereinkommen verpflichtet, geflüchtete Menschen zu unterstützen. Diese schließen weit mehr als die Aufnahme und Unterbringung der Menschen ein, es geht beispielsweise auch um eine angemessene gesundheitliche Versorgung. Und hier werden jene Menschen, die bei uns in Deutschland Schutz und Sicherheit suchen, häufig mit ihren Belastungen allein gelassen.
So hat sich Deutschland mit der Unterzeichnung des UN-Sozialpakts dazu verpflichtet, einen diskriminierungsfreien Zugang zur Gesundheitsversorgung sicherzustellen und mit der Unterzeichnung der UN-Antifolterkonvention zudem dazu, Menschen, die Opfer von Folter und Misshandlungen geworden sind, eine möglichst vollständige Rehabilitation zu ermöglichen.
Die EU-Aufnahmerichtlinie verpflichtet darüber hinaus die Mitgliedstaaten, besonders schutzbedürftige Asylsuchende, darunter psychisch erkrankte Geflüchtete und Überlebende von Folter, zu identifizieren und angemessen zu versorgen.
Diesem rechtlichen Rahmen gegenüber steht die Asylpraxis in Deutschland. So kann nur einem kleinen Teil der versorgungsbedürftigen Schutzsuchenden angemessene psychosoziale Unterstützung angeboten werden. Als Bundesverband der Psychosozialen Zentren für Geflüchtete und Folterüberlebende veröffentlichen wir regelmäßig Zahlen zur Versorgung von Schutzsuchenden, die Beratung und/oder Therapie in den Psychosozialen Zentren (PSZ) in Anspruch nehmen. Im Jahr 2020 wurden knapp 19.400 Klient*innen versorgt – so konnten die PSZ und ihre Kooperationspartner 2020 gerade einmal 4,6 % des potenziellen Versorgungsbedarfs abdecken (und mussten fast 10.000 Personen abweisen). Studien zur Prävalenz psychischer Folgen von Gewalt und Menschenrechtsverletzungen unter geflüchteten Menschen zufolge sind mindestens 30% der geflüchteten Menschen von depressiven Erkrankungen oder einer Posttraumatischen Belastungsstörung (Steel et al., 2009; Lindert et al., 2019) betroffen.1 Das entspricht etwa 550.000 Menschen, die als Schutzsuchende in Deutschland leben.
Die PSZ sind dabei oftmals die einzige Anlaufstelle für Menschen mit Fluchterfahrung. Durch die Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) können sie in den ersten 18 Monaten nach ihrer Ankunft nur bei akuten Schmerzen zu Ärzt*innen und haben keinen weiteren Zugang zu Fachärzt*innen oder Therapeut*innen. Das AsylbLG diskriminiert auch durch das bürokratische und hürdenreiche Verfahren zur Ausstellung von sog. Krankenscheinen; ungeschultes Personal in den Sozialämtern bescheidet oftmals ohne medizinische Fachkenntnisse Anträge negativ und oft fehlt die Sprachmittlung im medizinischen und therapeutischen Kontext.
Fast neun von zehn geflüchteten Menschen, die in den PSZ eine Beratung und/oder Therapie in Anspruch nehmen konnten, berichten von erlebter schwerer Gewalt oder Menschenrechtsverletzungen. Diese Erfahrungen sowie die diskriminierenden Aufnahmebedingungen in Deutschland haben erhebliche psychosoziale Folgen. Bei einer fehlenden Behandlung können sich psychische Erkrankungen wie Depressionen, Posttraumatische Belastungsstörungen oder Angstzustände chronifizieren, unter anderem mit Folgekosten für das Gesundheitssystem und die gesamte Gesellschaft.
Die PSZ verfolgen einen psychosozialen Menschenrechtsansatz, d.h. Prinzipien wie Menschenwürde, Diskriminierungsfreiheit, Gendergerechtigkeit und Kultursensibilität stehen im Zentrum der Arbeit. Geflüchtete Menschen werden als Expert*innen ihres eigenen Lebens verstanden und dabei unterstützt, für ihre Rechte einzutreten und mit den psychosozialen Folgen von Flucht, Gewalt und Folter umzugehen.
Es handelt sich um ein ganzheitliches Konzept, das sozialarbeiterische und pädagogische Angebote, Beratung, psychologische und psychotherapeutische Angebote und ggf. medizinische Hilfe umfasst. In den PSZ erhalten schutzsuchende Menschen unabhängige, kostenfreie Beratung, Gruppenangebote und Therapien. Alle Angebote werden mit Sprachmittlung angeboten. Dadurch wird geflüchteten Menschen ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen von Anfang an Zugang zu Information, Gemeinschafts‑, Beratungs- und Therapieangeboten ermöglicht. Neben der therapeutischen und sozialen Unterstützung ist auch die rechtliche Beratung geflüchteter Menschen ein wesentlicher Unterschied zur reinen psychosozialen Gesundheitsversorgung.
Doch auch andere Faktoren sind für die psychosoziale Versorgung relevant: Die freie Wohnortwahl sowie der Zugang zu Bildung und dem Arbeitsmarkt tragen zur Integration und Gesundheit von Menschen bei. Eine BAfF-Recherche zur Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Sammelunterkünften hat bspw. ergeben, dass gerade Kinder und Jugendliche besonders stark unter den eingeschränkten Lebensbedingungen leiden, es kaum Rückzugsräume gibt und sich psychische Symptomatiken durch den zusätzlichen Stress verstärken können.2
Ansätze, die die Folgen von Gewalt und Folter ausschließlich als behandlungsbedürftige psychische Krankheiten konzeptualisieren und deren Behandlungsansätze sich ausschließlich an der Behandlung psychischer Erkrankungen orientieren, ohne dabei die gesellschaftlichen Bedingungen im Blick zu haben, werden diesem Ansatz nicht gerecht. Ein psychosozialer Ansatz in der Unterstützung Überlebender von Gewalt und Folter stellt sich daher solidarisch an die Seite der betroffenen Personen und bemüht sich um ein umfassendes Verständnis der individuellen Situation unter Einbezug des speziellen Kontexts, in dem Gewalt entstanden ist und aufrechterhalten wird.
In den PSZ kann allerdings nur ein Bruchteil der Menschen eine Beratung und/oder Therapie in Anspruch nehmen, die Wartelisten sind lang und oft geschlossen, da die Kapazitäten bei Weitem nicht ausreichen. Auch die Finanzierung der Angebote in den Zentren ist äußerst prekär und erfolgt zum größten Teil aus zeitlich begrenzten Fördermitteln sowie aus Landesmitteln und zu kleineren Teilen aus Mitteln von Bund, Ländern und Kommunen.
Ohne das Engagement der Mitarbeiter*innen in den PSZ, die oft über die eigenen Kapazitätsgrenzen hinaus arbeiten, Spender*innen und Ehrenamtlichen könnten auch verschiedene Programme in den PSZ nicht angeboten werden, bspw. Mentor*innen-Programme für unbegleitete minderjährige Geflüchtete, durch die die Kinder und Jugendlichen beim Ankommen in Deutschland unterstützt werden.
Was braucht es also für einen Paradigmenwechsel?
Erfahrungen von Folter und Gewalt im Heimatland, aber auch auf der Flucht, können Menschen für ihr restliches Leben traumatisieren. Es braucht ein langfristiges Engagement von Bund und Ländern in der Finanzierung der PSZ. Die Aufstockung der Förderung durch die Bundesregierung im Zuge der Aufnahme Geflüchteter aus der Ukraine muss zu einer dauerhaften Übernahme staatlicher Verantwortung führen und für alle Geflüchteten gleich gelten.
Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag darüber hinaus auf die frühzeitige Identifizierung und Versorgung besonders Schutzbedürftiger verständigt. Mit dem BAfF-Modellprojekt »BeSafe« zeigen wir Wege auf, wie in Aufnahmeeinrichtungen und Beratungsstellen die besondere Schutzbedürftigkeit festgestellt und den besonderen Bedarfen nach Versorgung, Unterbringung oder Anhörung nachgegangen werden kann.
Die gesetzliche Verankerung von Sprachmittlung im Sozialgesetzbuch ist ebenfalls im Koalitionsvertrag festgehalten. Diese ist zentral, um die oft ehrenamtlich arbeitenden Sprachmittler*innen besserzustellen und die Qualität der Arbeit in den PSZ zu erhöhen. Bislang fehlt dabei aber eine entsprechende Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes – nur dann kann auch ein Großteil der Klient*innen der PSZ von den möglichen Änderungen profitieren.
Von der Bundesregierung bislang unbeachtet sind die Folgen der Asylrechtsverschärfungen 2016 und 2019, die dazu führen, dass schwere Erkrankungen nicht mehr ausreichend im Asyl- und Aufenthaltsverfahren beachtet werden, da die Anforderungen an Atteste kaum noch erfüllbar sind. Derzeit sieht die gesetzliche Regelung allein die ärztliche, also psychiatrische Expertise in der Begutachtung psychischer Erkrankungen vor, was aufgrund des Mangels an Fachkräften und der zumeist fehlenden Kenntnisse über den Zustand der Betroffenen dazu führt, dass viele keine Stellungnahmen im Asylverfahren beibringen können. Damit besonders schutzbedürftige Geflüchtete nicht abgeschoben werden, müssen die Stellungnahmen psychologischer Psychotherapeut*innen im asyl- und aufenthaltsrechtlichen Verfahren wieder berücksichtigt werden. Die gegenwärtige Verwaltungspraxis und gesetzliche Anforderungen an den Nachweis von Erkrankungen stehen damit fairen, zügigen und rechtssicheren Asylverfahren entgegen, wie sie der Koalitionsvertrag von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP zum Ziel gesetzt hat.
Die Bundesregierung zeigt sich grundsätzlich offen für Verbesserungen. Die Aufnahme Geflüchteter aus der Ukraine wurde durch eine breite Unterstützung und Solidarität in Gesellschaft und Politik begleitet. Vieles, was im Asylrecht und der Versorgung geflüchteter Menschen bis dahin unvorstellbar schien, wurde möglich gemacht. Die Bundesregierung wird sich an ihren eigenen Versprechen messen lassen müssen – und nicht zuletzt an den universell gültigen Menschenrechten, denen sie sich verpflichtet fühlt.
Lukas Welz ist Geschäftsleiter der BAfF, der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Überlebende von Krieg, Folter und Flucht.
Zur BAfF: Der Bundesverband der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer e.V. (BAfF) ist der Dachverband der Psychosozialen Zentren, Einrichtungen und Initiativen, die sich die psychosoziale und therapeutische Versorgung von Geflüchteten in Deutschland zur Aufgabe gemacht haben. Seit 25 Jahren engagiert sich die BAfF für vollen Schutz und gleiche Rechte für Geflüchtete und Überlebende von Folter. Weitere Informationen unter www.baff-zentren.org
1 Steel, Z., Chey, T., Silove, D., Marnane, C., Bryant, R. A., & van Ommeren, M.: Association of Torture and Other Potentially Traumatic Events With Mental Health Outcomes Among Populations Exposed to Mass Conflict and Displacement: A Systematic Review and Meta-analysis, JAMA: The Journal of the American Medical Association, 302(5) 2009, 537–549, https://doi.org/10.1001/jama.2009.1132; Lindert, J., Ehrenstein, O. S. von, Wehrwein, A., Brähler, E., о Schäfer, I.: Angst, Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen bei Flüchtlingen – eine Bestandsaufnahme, PPmP – Psychotherapie-Psychosomatik-Medizinische Psychologie, 68(01) 2018, 22–29, https://doi.org/10.1055/s‑0043–103344
2 BAfF e.V. (2020). Living in a box. Psychosoziale Folgen des Lebens in Sammelunterkünften für geflüchtete Kinder
(Gesundheit braucht Politik. Zeitschrift für eine soziale Medizin, Schwerpunkt: Psychische Erkrankungen, Nr. 3, Oktober 2022)