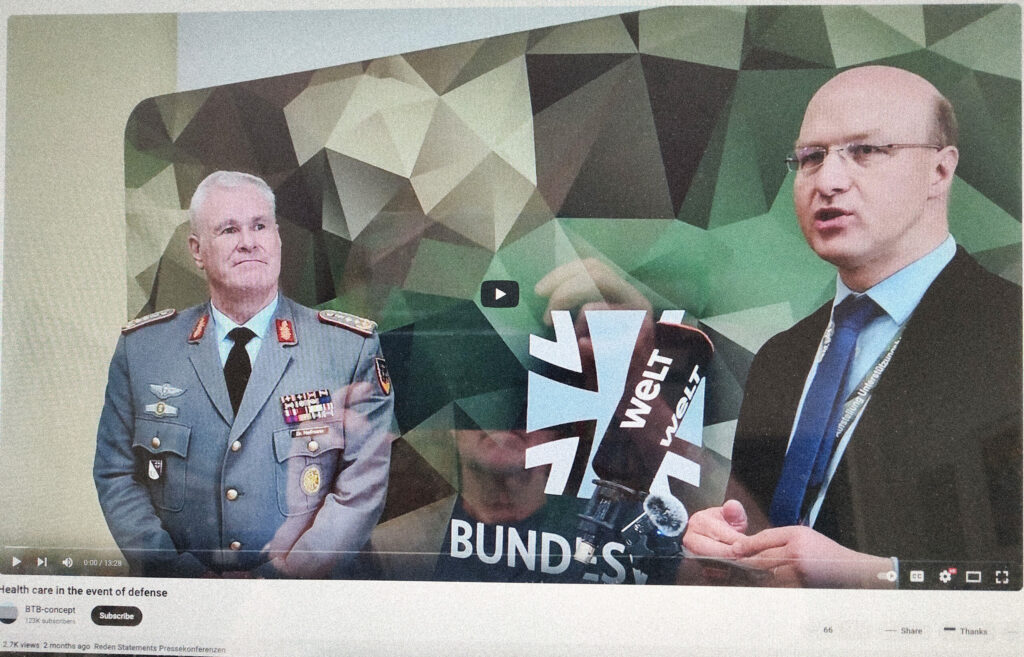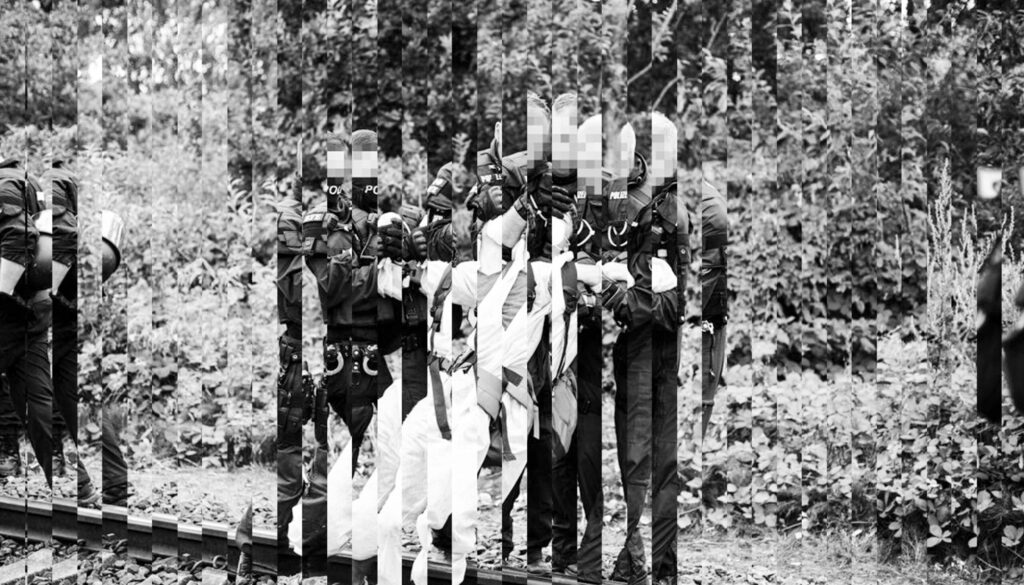Nadja Rakowitz für den vdää*
Nadja Rakowitz diskutiert weniger den Inhalt des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes (KHVVG) als die Art und Weise, wie es politisch durchgesetzt wurde. Sie sieht Momente einer Verselbständigung der Exekutive und befürchtet, dass sich dies unter Kanzler Merz verstärken wird.
Spätestens mit der Einführung des Preissystems der DRG 2004 wurden die deutschen Krankenhäuser kapitalistisch umgebaut. Dies und insbesondere der dazugehörende Konkurrenzkampf unter den Kliniken haben zu dramatischen Verschlechterungen der Versorgungs- und der Arbeitsbedingungen geführt. Seit 2015 rührt sich massiver Protest der Beschäftigten dagegen. Der zweiwöchige Streik an der Charité im Sommer 2015 für eine verbindliche gute Personalquote (Tarifvertrag Entlastung) machte den Anfang und verbreitete sich über viele Krankenhäuser in ganz Deutschland. Ein Höhepunkt war der 11-wöchige Streik von 6 Universitätskliniken in NRW im Jahr 2022; aber auch der Streik an der Uniklinik Jena (als erster dieser Art in den neuen Bundesländern) und der an der privatisierten Uniklinik Gießen/Marburg waren etwas Besonderes. Da die Streiks sich nicht mit einer Lohnerhöhung beschäftigten, sondern mit der Verbesserung der Arbeitsbedingungen und damit auch der Versorgungsbedingungen für die Patient*innen, bargen sie von Anfang an politisches Diskussionspotential, das über die unmittelbaren Fragen schnell hinausging. Alle diese Streiks waren auch Demonstrationen gegen die Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Dies schlug sich auch in den Arbeits- und Organisationsformen während des Streiks nieder. Die Kolleg*innen der Charité hatten das Konzept der so genannten Tarifberater*innen erfunden: Vertreter*innen aller Stations-Teams sollten an jedem entscheidenden Punkt gemeinsam mit der Tarifkommission diskutieren, damit es keine Abkoppelung der Gremien von der Basis gab, sondern gemeinsame Diskussion und enge Einbeziehung. Die Teams waren in den Verlauf des Arbeitskampfes eingebunden und konnten ihn aktiv mitgestalten, anstatt sich lediglich über das Ergebnis zu freuen oder zu klagen. Die Idee dahinter war, dass die Beschäftigten die Expert*innen sind, die wissen, wie viel Personal gebraucht wird. Das Konzept wurde bei allen folgenden Streiks für Entlastung übernommen – zum Teil mit einem anderen Wort für die Tarifberater*innen: Streikdelegierte oder ähnliches. Dieser Prozess ist durchaus als einer der Wortergreifung der Beschäftigen anzusehen und als einer der Demokratisierung von Tarifauseinandersetzungen.
Auf den konservativen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) machte das alles offensichtlich solchen Eindruck, dass er ein unerwartetes Gesetz einbrachte: In diesem wurde beschlossen, dass die Pflege (am Bett) aus den DRG herausgenommen wird und im Modus der Selbstkostendeckung bezahlt wird. Eine Sensation, denn das war das erste Mal seit Jahrzehnten, dass ein Gesetz in die komplett entgegengesetzte Richtung wie die immer weiteren marktförmigen Reformen ging. Leider blieb dies bislang die einzige positive politisch gezogene Konsequenz aus dem ganzen DRG-Schlamassel.
Sozialdemokratie und Revolution
Und dann wurde Karl Lauterbach (SPD) Gesundheitsminister. Am 23. Oktober 2022 kündigte er an prominenter Stelle im heute Journal an, dass die von ihm eingesetzte »Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung« an einem Konzept für eine »Überwindung der Fallpauschalen« arbeite. Das Fallpauschalensystem habe sich seit seiner Einführung, an der Lauterbach als damaliges für Gesundheitspolitik zuständiges Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion selbst beteiligt gewesen war, »so stark verselbständigt, dass der ökonomische Druck zu stark« sei.1
Am 6. Dezember stellte die 17-köpfige Expertenkommission die »Revolution« in einer Pressekonferenz2 vor. Neben einigen Mediziner*innen und Jurist*innen sitzen in dieser Kommission eine Expertin für Pflege, ein Pharmazeut, außerdem Volkswirte und Gesundheitsökonomen3. Von letzteren nicht irgendwelche, sondern mit Boris Augurzky und Reinhard Busse genau Jene, die bislang immer nur dadurch auffielen, dass sie noch mehr Markt und Konkurrenz einführen und gleichzeitig Krankenhäuser schließen und zentralisieren wollen. Weder waren Vertreter*innen der GKV und PKV dabei, noch welche der Gewerkschaften oder der organisierten Ärzteschaft (worüber diese sehr empört war und ist, weil sich Ärzt*innen ja allzu oft für Expert*innen halten und nicht für Lobbyist*innen im Eigeninteresse…), es waren aber auch keine Vertreter*innen der Pharma- oder Medizingeräteindustrie dabei. So weit so gut.
Zunächst fiel bei der Pressekonferenz auf, dass Augurzky und Busse nicht auf dem Podium saßen, sondern neben dem Minister nur Praktiker*innen aus der Kommission: Tom Bschor, langjähriger Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie der Schlosspark-Klinik Berlin, Christian Karagiannidis, Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin und Irmtraut Gürkan, die unter anderem stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Berliner Charité ist. Sowohl Lauterbach als auch Karagiannidis betonten, dass das vorgestellte Konzept ein »rein wissenschaftliches« sei, bei dem man Lobbyismus wie auch die Politik ferngehalten habe. Der Sinn dieses Framings wurde dann in der Aktuellen Stunde des Bundestags am 15.12.2022 deutlich. Hier sagte Lauterbach in Reaktion auf die Kritik an der Reform durch Ates Gürpinar von der LINKEN: »Das sind kluge Vorschläge … Sie glauben, dass Ihre Vorschläge besser sind als die Vorschläge der Wissenschaft? Das ist eine Missachtung der Wissenschaft. Was glauben Sie denn, wer Sie sind?«4
Was zuvor schon bisweilen in der Debatte über Corona eingeübt wurde (unabhängig davon, ob inhaltlich richtig oder nicht), war plötzlich »normal« geworden: Kritik im Parlament wurde einfach mit dem Hinweis auf die Wissenschaftlichkeit eines politischen Vorschlags abgewürgt. Das will uns weismachen, Wissenschaft – zumal Gesundheitsökonomie – agiere im politisch-ökonomisch luftleeren Raum und ihre Resultate bedürften keiner politischen Diskussion mehr. Wie sehr sich neoliberale Vorstellungen in das Konzept drängen, kann man aber an den Vorschlägen der Kommission zeigen (siehe dazu den Artikel von Thomas Böhm in diesem Heft, S. 5 ff.).
Ein kleiner Sieg im Diskurs
Auffallend war dennoch, dass sich inzwischen große Risse im argumentativen Gebäude der DRG-Verteidigung zeigten. In der oben erwähnten Pressekonferenz hatte man den Eindruck, dass dieses Gebäude – zumindest was die Problemanalyse angeht – in sich zusammenfällt. Auch das Kommissionspapier liest sich wie eine Bankrotterklärung des DRG-Systems; viele lange bekannte Argumente der Fallpauschalenkritiker*innen werden plötzlich vom Gesundheitsminister genannt. Von »Daseinsvorsorge« ist plötzlich wieder die Rede und der von Kritiker*innen des Systems gebrauchte Vergleich mit der Feuerwehr, die schließlich auch bezahlt werde, wenn es nicht brennt, wird plötzlich nicht mehr ignoriert oder belächelt, sondern zustimmend aufgegriffen. Es ist eine Freude zu sehen, wie die Expert*innen bei dieser Pressekonferenz unter Rechtfertigungsdruck geraten und erläutern müssen, warum man nicht die Selbstkostendeckung für die gesamte Krankenhausfinanzierung einführen wolle. Es kamen zwar nicht mehr als die üblichen ideologischen Parolen, die einer kritischen Prüfung5 nicht standhalten, aber diskursiv können wir das dennoch als einen Erfolg für die Beschäftigten in der Bewegung ansehen. Unser Vorschlag der Selbstkostendeckung muss von ihnen zumindest aufgenommen und abgewehrt werden.
Aber hat sich auch die gesundheitspolitische Wirklichkeit geändert? Mitnichten folgt aus der Reform die »Überwindung der DRG«. Bereits die Präambel erläutert: »Die Kommission geht … davon aus, dass Leistungsanreize erhalten bleiben müssen, weil auch eine ausschließlich leistungsunabhängige Vergütung – etwa in Form eines zu 100 Prozent garantierten Budgets oder einer Selbstkostendeckung – Fehlanreize setzt und erhebliche Risiken für eine patienten- und bedarfsgerechte Versorgung sowie finanzielle Risiken für die Kostenträger auslösen würde.«
Neben dem Eingeständnis, dass es nicht um die Überwindung der DRG geht, ist interessant, dass die Kommission es offensichtlich für notwendig hält, sich von der Selbstkostendeckung – über Jahrzehnte ein Unwort – begrifflich abzugrenzen. Wie unscharf ihre Begrifflichkeiten sind, zeigt sich daran, dass sie ein »garantiertes Budget« und Selbstkostendeckung in einem Atemzug nennen. Im Rahmen von Budgets bleiben aber weiterhin Gewinne und finanzielle Fehlanreize bestehen (Kostendumping, Verschiebung/Beendigung der Leistungserbringung bei Aufbrauchen des Budgets); während bei der Selbstkostendeckung eine Zweckbestimmung für die Ausgaben genauso gesetzt ist und Gewinne nicht mehr möglich sind. Der große Vorteil der Selbstkostendeckung liegt gerade darin, dass die bedarfsgerechte Versorgung im Mittelpunkt steht, unbelastet von finanziellen Zwängen oder Erwägungen.
Umgang mit den Ländern
In dem im Dezember 2022 vorgestellten Kommissionpapier gab es drei wesentliche Erneuerungen für die Organisation und die Finanzierung der Krankenhäuser: Die Krankenhäuser sollten in drei Versorgungsstufen eingeteilt werden: »Level I«, »Level II« und »Level III«, was nichts wirklich Neues ist und nur den altbekannten, in vielen Bundesländern mittlerweile wieder aufgegebenen Versorgungsstufen bei Krankenhausplanungen: Grundversorgung, Zentralversorgung und Maximalversorgung entsprach. Jedem Level sollten bundeseinheitliche Strukturqualitätsanforderungen und insgesamt 128 Leistungsgruppen zugeordnet werden. Und die Finanzierung sollte zum Teil umgestellt werden auf so genannte Vorhaltepauschalen. Letztere war in diesem Papier noch etwas anders gestrickt als im jetzigen Gesetz. Aber weder diese noch die heutigen Vorhaltepauschalen halten, was sie versprechen.
Was besonders die Bundesländer verärgert hat, war das Konzept der Level und der Leistungsgruppen: Erstens hätte dies bedeutet, dass der größte Teil der bestehenden Krankenhäuser in Deutschland die Anforderungen von Level II nicht erreicht hätte und zum Teil zu Schließung gezwungen gewesen wären. Zweitens hätte dies schlicht die Entmachtung der Länder in der Krankenhausplanung bedeutet, denn die bundesweit vorgeschriebenen Kriterien hätten einen großen Teil der Planungskompetenz, die verfassungsmäßig den Ländern zusteht, unterminiert bzw. aufgehoben. Unabhängig davon, ob man dieses föderale Moment gesundheitspolitisch für sinnvoll hält oder nicht, setzte sich hier der Bundesgesundheitsminister einfach über die Länder hinweg. Das ließen diese aber nicht mit sich machen und in dem Kompromisspapier vom 10.07.2023 »Finales Eckpunktepapier von Bund und Ländern« sind die Level entsprechend nicht mehr zu finden, sondern nur noch Leistungsgruppen, die in abgeschwächter Form aber immer noch eine ähnliche Funktion haben, allerdings mit Ausnahmen, die die Länder bestimmen können.
Zur Vordertür also rausgeworfen, führt Lauterbach die Level bei nächster Gelegenheit – ohne sich um Verfassungsfragen zu kümmern – wieder ein: Am 19.10.2023 wurde das »Gesetz zur Förderung der Qualität der stationären Versorgung durch Transparenz (Krankenhaustransparenzgesetz)« in dritter Lesung im Bundestag mit den Stimmen der Koalition und gegen die Stimmen der Opposition verabschiedet. Das Gesetz ist nach Angaben des BMG nicht zustimmungspflichtig durch den Bundesrat. Die Standorte der Krankenhäuser werden auf dieser Transparenzliste, dem Bundes-Klinikatlas6 nach den vorgehaltenen Leistungsgruppen in folgende Level unterteilt: Level 3U sind Hochschulkliniken und die müssen anbieten: 5 internistische LG, 5 chirurgische LG, LG Intensivmedizin, LG Notfallmedizin, zusätzlich 8 weitere LG; Level 3‑Krankenhäuser müssen dieselben LG wie Level 3U anbieten, sind aber keine Hochschulkliniken; Level 2 muss anbieten: 2 internistische LG, 2 chirurgische LG, LG Intensivmedizin, LG Notfallmedizin, zusätzlich drei weitere LG; Level 1n-Krankenhäuser müssen anbieten die LG Allgemeine Innere Medizin, LG Allgemeine Chirurgie, LG Intensivmedizin, LG Notfallmedizin; Level F bedeutet Spezialisierung auf eine »bestimmten Erkrankung, Krankheitsgruppe oder Personengruppe«, Zuordnung durch Krankenhausplanung der Länder, wenn sie einen »relevanten Versorgungsanteil« leisten und Level 1i-Krankenhäuser bieten sektorenübergreifende Versorgung an und in der Regel keine Notfallmedizin, Zuordnung wird durch die Krankenhausplanung der Länder vorgenommen. Diese soll den Patient*innen helfen, das richtige Krankenhaus für ihr Anliegen zu finden und damit die Qualität der Versorgung zu steigern.
Informationen über die Qualität der jeweiligen Krankenhausbehandlung sind selbstverständlich sinnvoll. Da es solche Informationen schon gibt (z.B. Weisse Liste, AOK-Gesundheitsnavigator, Qualitätsberichte der Krankenhäuser), erschließt sich die Notwendigkeit dieser weiteren Zusammenstellung nicht wirklich. Es sei denn, es gibt andere Absichten – und die gibt es: Die Transparenzliste soll als weiteres Instrument zur Schließung von kleinen Krankenhäusern dienen und sie soll die von den Bundesländern abgelehnten Level durch die Hintertür wieder einführen. In Wirklichkeit geht es weniger um Qualität als um diese Ziele. Die Qualitätserzählung dient hier wie bei der Schließungswelle und Zentralisierung nur der Legitimation einer sonst schwer vermittelbaren Reform und der Ablenkung. Wenn es wirklich um eine Verbesserung der Qualität ginge, müsste man ganz andere Maßnahmen ergreifen: Eine Verbesserung der Personalausstattung, die Abschaffung der DRGs, eine kostendeckende Finanzierung, also auch sichergestellte Übernahme der Investitionskosten durch die Länder. Krankenhäuser mit einem solchen Register öffentlich zu beurteilen, führt eher zur Vertuschung oder/und zur Patient*innenselektion, um Komplikationen zu vermeiden. Insgesamt ist es offensichtlich, dass das Transparenzgesetz der Versuch ist, den Konsens zwischen Bund und Ländern im Eckpunktepapier durch die Hintertür wieder rückgängig zu machen. Es handelt sich eindeutig um einen Eingriff in die Planungshoheit der Länder.7
Auswirkungsanalyse? Nur für Koalitionspartner
Der Gesundheitsminister hatte lange vor Verabschiedung des Gesetzes angekündigt, dass er eine Auswirkungsanalyse bzw. ein Tool zur Verfügung stellen werde, so dass man in den Bundesländern und vor Ort schon mal konkreter ausloten könne, was die Reform bedeuten wird. Bis Anfang Oktober 2024 gab es dies aber immer noch nicht, obwohl die 2./3. Lesung im Bundestag am 17.10.2024 war und der Bundesrat schließlich am 22.11.2024 abgestimmt hat. Schon die Tatsache, dass die beiden Lesungen an einem Tag waren, dass die Anhörung zu diesem komplizierten und wirkmächtigen Gesetz nur zwei Stunden gedauert hat, zeigt, dass die Regierung genauso weitergemacht hat wie bei der Vorstellung des Konzepts. Auf Expertise von anderen Parlamentarier*innen wie von Expert*innen außerhalb der Kommission wird keinen Wert gelegt.
Der Umgang mit der lang geforderten Auswirkungsanalyse zeugt erneut von einer Missachtung parlamentarisch demokratischer Gepflogenheiten auf Seiten von Minister Lauterbach: Einen Tag vor der Verabschiedung in 2. und 3. Lesung hatte der Gesundheitsausschuss dem KHVVG mit den Stimmen der Ampel und gegen die Stimmen aller Oppositionsfraktionen zugestimmt. Laut dem Internetportal BibliomedManager hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in der Ausschusssitzung eingeräumt, dass die seit Monaten mit Spannung erwartete Auswirkungsanalyse zur geplanten Krankenhausreform bereits vorliege und von den Ampelfraktionen genutzt werde. »Auf Nachfrage des gesundheitspolitischen Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Tino Sorge, erklärte Lauterbach, die Auswirkungsanalyse sei ›bereits in der Nutzung der regierungstragenden Fraktionen‹. Die Parlamentarier von SPD, Grünen und FDP hätten demnach ›Simulationen gezeigt bekommen‹, die die Auswirkungen der Klinikreform vor Ort darstellen.«8 Zurecht kritisierte dieses Vorgehen Sorge als »Tiefpunkt des Parlamentarismus und des Föderalismus …Offensichtlich unterscheidet Karl Lauterbach nun zwischen Abgeordneten erster und zweiter Klasse«. (Ebd.)
Auch wenn Gesundheitsausschussmitglieder von der Ampelkoalition sagten, dass die Präsentation am 16.10.2024 ihnen auch nicht wirklich geholfen habe, mussten die Vertreter*innen der Oppositionsparteien gänzlich ohne diese Informationen des BMG entscheiden. Als das Tool dann angewendet werden konnte, beschrieb das Deutsche Ärzteblatt das Ergebnis: »Demnach haben 60 Prozent der Regel- und Schwerpunktkrankenhäuser angegeben, dass sie die Vorgaben überwiegend (70 bis 90 Prozent der Vorgaben) oder nur teilweise (50 bis 70 Prozent) erfüllen können. Bei den grundversorgenden Häusern haben 82 Prozent erklärt, dass sie die Vorgaben nicht gänzlich erfüllen können.«9 Das ist kein Zufall, sondern Methode, denn mit der Verabschiedung des Gesetzes wurde von Karl Lauterbach klar und offen ausgesprochen, was z.B. das Bündnis »Krankenhaus statt Fabrik« schon die ganze Zeit gesagt hat: dass durch diese Reform in den nächsten Jahren hunderte Krankenhäuser (von aktuell ca. 1.700) geschlossen werden sollen. Kein Wunder, dass dieses Vorhaben weniger demokratisch, sondern autoritär durchgedrückt wird.
Schade, dass die wichtigste gesellschaftliche Oppositionsinstanz in diesem Fall, nämlich die Gewerkschaft ver.di, ein Totalausfall war. Es gab während der zwei Jahre seit Ankündigung der Reform keinen nennenswerten Widerstand dagegen von Seiten ver.dis. Das heißt mitnichten, dass die ver.di-Mitglieder oder Beschäftigten des Fachbereichs C diese Politik für richtig halten. Im Gegenteil. Man hörte an der Basis bei betrieblichen wie gewerkschaftlichen Interessensvertreter*innen großen Unmut über diese Reform und über den ausbleibenden massiven Protest von Seiten der Gewerkschaft.
Wehret den Anfängen
Das KHVVG wurde vom BMG an bestimmten Punkten autoritär durchgesetzt. Wir erleben Ansätze einer Verselbständigung der Exekutive, die in anderen liberalen Demokratien schon viel beängstigendere Formen angenommen hat. Ein Aufschrei der demokratischen Öffentlichkeit blieb aus. Es ist aber abzusehen, dass sich diese Art, Politik zu machen, auch in Deutschland verschärfen wird. Der zukünftige Kanzler Friedrich Merz hat schon Andeutungen gemacht, dass er sich politisch an Trump orientieren will, etwa wenn er ohne Rücksicht auf Gewaltenteilung oder geltendes Recht Grenzschließungen per Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers anordnen will10 oder im so genannten »Kanzlerduell« die Pflichtverteidigung von Menschen in Abschiebehaft in Frage stellt11.
Opposition und Widerstand nicht nur gegen die zukünftige Krankenhauspolitik einer schwarz-roten Koalition werden sicher nicht leichter werden. Zumal ver.di mutmaßlich weiterhin als relevanter Akteur ausfallen wird, solange die SPD regiert.
Nadja Rakowitz ist Politologin und Medizinsoziologin, arbeitet als Geschäftsführerin beim vdää* und macht Bildungsarbeit für ver.di und die RLS.
- Siehe z.B. hier: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenhaus/krankenhausreform/faq-krankenhausreform.html ↩︎
- Siehe das Video der Pressekonferenz vom 06.12.2022 zur Reform der Krankenhausfinanzierung: https://www.youtube.com/watch?v=mIjLlmAshu0 ↩︎
- Hier findet man die Liste der Mitglieder https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/K/Krankenhausreform/Liste_Mitglieder_der_Regierungskommission.pdf ↩︎
- Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht, 76. Sitzung, Plenarprotokoll 20⁄76, 15. Dezember 2022, S. 9076; in: https://dserver.bundestag.de/btp/20/20076.pdf ↩︎
- Siehe Bündnis Krankenhaus statt Fabrik: Factsheet: Kostendeckung 2.0. Unsere Vorstellungen einer alternativen Krankenhausfinanzierung, in: https://www.krankenhaus-statt-fabrik.de/53215 ↩︎
- Siehe https://bundes-klinik-atlas.de/ ↩︎
- Vgl. KH statt Fabrik: Bewertung Krankenhaustransparenzgesetz, November 2023; in: https://www.krankenhaus-statt-fabrik.de/2024/03/04/bewertung-krankenhaustransparenzgesetz/ ↩︎
- Auswirkungsanalyse-Tool ist schon in Gebrauch, in Bibliomed Manager vom 16.10.2024; in: https://www.bibliomedmanager.de/news/auswirkungsanalyse-tool-ist-schon-in-gebrauch ↩︎
- Mehrheit der Kliniken kann Leistungsgruppen nicht erfüllen, Deutsches Ärzteblatt, 18. November 2024, https://www.aerzteblatt.de/treffer?mode=s&wo=1041&typ=1&nid=155806&s=Kliniken&s=Leistungsgruppen&s=Mehrheit&s=der&s=erf%FCllen&s=kann&s=nicht ↩︎
- Zurückweisungen ohne Ausnahme. Merz will am ersten Kanzler-Tag alle Grenzen dichtmachen, in: NTV vom 23.01.2025; https://www.n‑tv.de/politik/Merz-will-am-ersten-Kanzler-Tag-alle-Grenzen-dichtmachen-article25509641.html; Sieg bei der Bundestagswahl: Das will Merz als Kanzler an Tag eins angehen, Merkur 27.02.2025; https://www.merkur.de/politik/tag-eins-angehen-wahlergebnisse-bundestagswahl-2025-das-will-merz-als-kanzler-an-zr-93590088.html ↩︎
- Das kann man in voller Länge hier anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=B3z2T7ed6Os; Kritik an Merz übt diesbezüglich Pro Asyl: Die CDU unter Merz gefährdet Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Deutschland, Pro Asyl 29.01.2025; https://www.proasyl.de/news/die-cdu-unter-merz-gefaehrdet-demokratie-und-rechtsstaatlichkeit-in-deutschland/ ↩︎