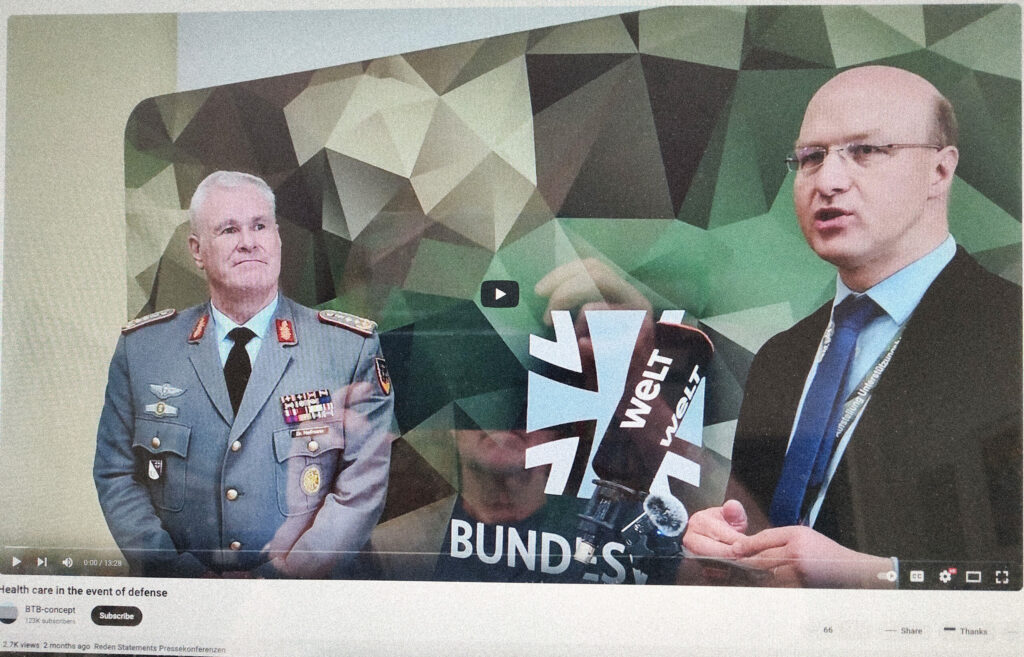Von Thomas Böhm für den vdää.
Die Positionen der Parteien im Bundestag
waren wenig überraschend: Die Koalitionsfraktionen (SPD, Grüne, FDP) stimmten für das Gesetz, alle anderen Parteien dagegen. (Es gab nur zwei »Abweichler«: Ein SPD- und ein FDP-Abgeordneter haben mit nein gestimmt)
Die Bundesländer
haben zunächst in einer einstimmigen Entschließung folgende zentrale Kritikpunkte vorgetragen: Sie kritisieren die fehlende Auswirkungsanalyse und die fehlende Entbürokratisierung. Die Vergütungssystematik führe nur begrenzt zu einer Entökonomisierung, der Zeitplan der Einführung sei zu knapp bemessen, die Regelungen zur sektorenübergreifende Versorgung seien unzureichend und schöpften das Ambulantisierungspotential nicht aus. Sie fordern, dass das Gesetz im Bundesrat zustimmungspflichtig ist. Sie akzeptieren die Einführung von leicht entschärften Mindestvorhaltezahlen, obwohl sie sie (richtigerweise) als Eingriff in die Planungshoheit der Länder bewerten. Sie plädieren für deutlich erweiterte Entscheidungsspielräume für Ausnahmeregelungen durch die Länder. Beim Transformationsfonds wollen sie, dass der Bund sich mit 20 Milliarden beteiligt. Der Anteil der Krankenkassen (Gesundheitsfonds) soll 15 Milliarden betragen. Der Anteil der Länder soll mindestens 30% (incl. Trägeranteil!!) des jeweiligen Förderprojekts sein.
In der entscheidenden Bundesratssitzung am 22.11.2024 haben sechs Länder (Baden-Wüttemberg, Bayern, Brandenburg, NRW, Sachsen, Sachsen-Anhalt) für die Anrufung des Vermittlungsausschusses gestimmt. Die Länder Bremen, Hamburg, Meck-Pom, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Saarland stimmten mit Nein. Berlin, Hessen und Schleswig-Holstein haben sich enthalten. Die Stimme von Thüringen wurde für ungültig erklärt. Damit war der Antrag abgelehnt.
Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
hält eine grundlegende Reform der Krankenhausversorgung für notwendig und beklagt die Nichtbeteiligung der Selbstverwaltung (und damit der GKV) am Reformprozess. Er geht von erheblichen Merkosten für die Kassen aus. Leistungsgruppen (LG) werden begrüßt, allerdings seien sie und die Qualitätskriterien zu wenig ausdifferenziert. Auch die Mindestvorhaltezahlen werden begrüßt, allerdings sollte nicht nur die Vorhaltevergütung gestrichen werden, sondern ein Leistungsausschluss erfolgen. Qualitätsanforderungen sollen nicht in Kooperation erbracht werden dürfen. Statt der Vorhaltevergütung will die GKV eine »populationsbezogene« Vergütung (also eine Form der Capitation). Die Finanzierung des Transformationsfonds aus dem Gesundheitsfonds der Kassen wird abgelehnt. Die SüV (ehemals Level Ii) werden als »Transformationschance« gesehen.
Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV)
begrüßt die Reform, weil Strukturänderungen wegen der hohen Krankenhaus- und Bettendichte notwendig seien. Die Vorhaltevergütung und der vollständige Ausgleich von Tarifsteigerungen werden als Rückkehr zur Selbstkostendeckung gesehen und abgelehnt. Stattdessen wird für die Weiterentwicklung des DRG-Systems plädiert. Die Finanzierung des Transformationsfonds wird als verfassungswidrig bezeichnet. Der Bürokratieaufbau wird kritisiert. Die PKV will besser in die Selbstverwaltung einbezogen werden.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG)
kritisiert die fehlende Übergangsfinanzierung bis zum Wirksamwerden der Reform. Eine Planung nach LG wird begrüßt, allerdings wird die Beschränkung auf die NRW-LG gefordert und Mindestvorhaltezahlen werden abgelehnt. Die Vorhaltevergütung sei nicht fallzahlunabhängig, erzeuge massiven Bürokratieaufwand sei keine Entökonomisierung und keine Existenzsicherung. Sie verteile die zu geringen Mittel nur um. Stattdessen sollten vorhandene Finanzierungsinstrumente (Sicherstellungs‑, Notfallstufen‑, Zentrumszuschlag) ausgeweitet und eine »zielgenaue Methode der Strukturkostenfinanzierung« entwickelt werden. Das Potential der SüV werde nicht ausgeschöpft und die Finanzierungsregelungen seien nicht ausreichend, um sie betriebswirtschaftlich zu sichern. Die zeitliche Befristung wesentlicher Versorgungsaufgaben gebe keine Planungssicherheit. Bei den MD-Prüfungen fehle die »umfassende Entschlackung«. Der Transformationsfonds müsse aus Mitteln des Bundes und der Länder und nicht aus dem Gemeinsamen Fonds der Kassen und durch Trägeranteile gespeist werden. Das Gesetz stelle einen erheblichen Eingriff in die Landesplanungen dar und sei deshalb zustimmungspflichtig. Der Gesetzesentwurf blende die Fachkräftesituation völlig aus und vernachlässige die Aus- und Weiterbildungssituation.
Auch die Gewerkschaft ver.di
kritisiert die fehlende kurzfristige Existenzsicherung der Krankenhäuser und das »ungesteuerte Kliniksterben«. Das Ziel der »Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen, flächendeckenden Versorgung« wird begrüßt. Die »gewählten Ansätze scheinen jedoch nicht konsequent und weitreichend genug«. Notwendig sei eine bedarfsgerechte Personalausstattung und die Sicherstellung der wohnortnahen Versorgung. Es fehle eine umfassende Bedarfs- und Folgenabschätzung. Die Reform müsse unter Beteiligung der betroffenen Beschäftigten umgesetzt werden. Für eine tatsächliche Entökonomisierung gingen die Reformansätze nicht weit genug. Ver.di fordert die gewerkschaftliche Beteiligung bei der Weiterentwicklung der LG und Qualitätskriterien. Für den Transformationsfonds dürfen keine Mittel aus dem Gemeinsamen Fonds verwendet werden bzw. die Privatversicherten müssen beteiligt werden. Die Vorhaltevergütung sei weiterhin fallzahlabhängig und setze weiterhin negative Anreize. Es wird die Ausgliederung sämtlicher Personalkosten aus den Fallpauschalen und ihre kostendeckende Refinanzierung gefordert. »ver.di setzt sich für die vollständige Abschaffung und Überwindung der Fallpauschalen ein.« Eine Gewinnverbot wird allerdings nicht gefordert. Die Refinanzierung von Tarifsteigerungen wird ausdrücklich begrüßt. LG werden grundsätzlich begrüßt, in den Qualitätskriterien müssten Personalbemessungssysteme wie die PPR 2.0 integriert werden. Die Krankenhausbedarfsplanung müsse in Versorgungsregionen erfolgen. Ver.di spricht sich nicht gegen Mindestvorhaltezahlen aus, sie müssten nur so gewählt sein, das regionale Versorgungsbedarfe nicht gefährdet werden. Ausnahmetatbestände für die Länder seien »grundsätzlich sinnvoll«, es müsste jedoch »einheitliche Kriterien« und tatsächliche Nachweise für das Vorliegen solcher Ausnahmetatbestände geben. Bei den SüV wird kritisiert, dass sie nicht auch auf die »flächendeckende Notfallversorgung« ausgerichtet sind. Es wird ihre Angliederung an Level II-Krankenhäuser gefordert. Die Finanzierung der SüV über Tagespauschalen wird abgelehnt, weil sie ein »Einfallstor für renditeorientierte Investoren« sein könnten. Auch bei den SüV wird die vollständige Ausgliederung und Refinanzierung aller Personalkosten gefordert.
Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)
überschreibt ihre Stellungnahme mit »Notwendige Strukturreform bleibt weitgehend aus – stattdessen massive Belastung der Beitragszahlenden«. Sie plädiert für die Beibehaltung des DRG-Systems. Die angestrebte Entökonomisierung führe in die Irre. Wenn eine Vorhaltevergütung eingeführt wird, sollte sie populationsbezogen sein. Qualitätskriterien dürften keine Ausnahmeregelungen enthalten. Mindestvorhaltezahlen werden ausdrücklich begrüßt. Die Weiterentwicklung der LG und Qualitätskriterien muss durch die Selbstverwaltung (Kassen und DKG) erfolgen. Der Transformationsfonds sei eine staatliche Aufgabe und dürfen nicht auf die Beitragszahler abgewälzt werden, dies sei verfassungsrechtlich fragwürdig. Die volle Refinanzierung der Tarifsteigerungen wird abgelehnt. Weiter meint die BDA: »Nicht alle Krankenhäuser müssen gerettet werden« und »Krankenhausabrechnungen müssen vollständig geprüft werden.«
Der Marburger Bund (MB)
bewertet den Gesetzesentwurf kritisch, auch wenn er eine Krankenhausreform für erforderlich hält. Er kritisiert das Fehlen einer »Bedarfs- und Auswirkungsanalyse« und der Entbürokratisierung. Auch die Auswirkungen auf die ärztliche Tätigkeit und Weiterbildung nicht mitbedacht. Die ärztlichen Personalvorgaben in den neuen LG seien unrealistisch. Mit der Vorhaltevergütung erfolge keine grundsätzliche Abkehr vom DRG-System und keine Entökonomisierung. Sie sei nicht fallzahlunabhängig. Es wird gefordert, dass die Vorhaltevergütung die »patientennahen Personalkosten abdeckt«. Es erfolge kein Bürokratieabbau. Der Transformationsfonds müsse aus Steuermitteln finanziert werden. Die Planung nach den NRW-LG wird befürwortet. Die fünf neuen LG werden abgelehnt, genau wie die Mindestvorhaltezahlen. Sektorenübergreifende Versorgung wird grundsätzlich begrüßt, es sei aber unklar, ob die SüV überhaupt versorgungsrelevant betreibbar seien. Die Refinanzierung der Tarifsteigerungen wird begrüßt. Der Transformationsfonds müsse mit staatlichen Mitteln finanziert werden. Das Gesetz wird als im Bundesrat zustimmungspflichtig angesehen.
Die Bundesärztekammer (BÄK)
begrüßt eine »grundlegende Krankenhausreform«. Kritisiert wird die fehlende Einbindung des »Sachverstands der Ärzteschaft« und die Nichtberücksichtigung der ärztlichen Weiterbildung und Personalausstattung sowie die fehlende Entbürokratisierung. Auf den letzten Drücker ist es der BÄK gelungen, die Einführung des ärztlichen Personalbemessungssystems im KHVVG unterzubringen. Die Qualitätskriterien zur Anrechnung von Arztzahlen und ‑qualifikationen werden als zu streng kritisiert. Die Mindestvorhaltezahlen und die Mindestfallzahlen für onkochirurgische Leistungen werden abgelehnt. Es werden erweiterte Rechte der Länder bei der Gewährung von Ausnahmeregelungen und die Streichung der Minuten-Erreichbarkeitskriterien gefordert. Für SüV wird die Geltung der Qualitätskriterien und Personalbesetzung wie bei der stationären Versorgung gefordert. Auch hier sollten die ärztlichen und pflegerischen Personalkosten »kostendeckend refinanziert« werden. Die Ermächtigung der SüV zur hausärztlichen Versorgung wird abgelehnt. Der Transformationsfonds müsse aus Landes- und Bundesmitteln und nicht aus dem gemeinsamen Fonds finanziert werden.