Wir dokumentieren hier (leicht gekürzt) den Vortrag von Hans-Ulrich Deppe auf dem Gesundheitspolitischen Forum des Vereins Demokratischer Arzt*innen und des Solidarischen Gesundheitswesens am 3. November 2023 in Marburg.
50 Jahre ist es her, dass hier in Marburg der erste medizinkritische Kongress unter dem Motto »Medizin und gesellschaftlicher Fortschritt« stattfand. Als damals Beteiligter stelle ich mir heute die Fragen: Warum haben wir damals dieses Projekt eigentlich gestartet? Warum haben wir es zu dieser Zeit gemacht? Was wollten wir erreichen? Wie waren die Voraussetzungen? Darüber hinaus soll mein Beitrag unsere aktuelle gesellschaftspolitische Diskussion anregen, obwohl sich Vieles geändert hat! Die vergangenen Jahrzehnte waren in der Tat eine historische Periode mit tiefgreifenden Veränderungen, Kriegen und dramatischen Um- und Zusammenbrüchen.
Was waren die gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Hintergründe der damaligen Zeit? Wie war der »Zeitgeist« Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre?
Es herrschte damals eine Stimmung des Umbruchs und Aufbruchs in der Gesellschaft verbunden mit einer scharfen Gesellschaftskritik. Im Detail äußerte sich die kritische Stimmung wie folgt: In der Politik kam es zur Ablösung des Adenauer-Regimes der Nachkriegszeit. Es kam zur Ablösung des »Kalten Kriegs«, der Konfrontation der Systeme Kapitalismus –Sozialismus, und die folgende Sozialliberale Koalition (SPD/FDP) startete mit einer neuen Ostpolitik.
Nach 12 Jahren Verbot wurde 1968 die kommunistische Partei wieder gegründet – prompt folgten fünf Jahre später die Berufsverbote.
Die Wirtschaft war durch eine ökonomische Krise gekennzeichnet. Die steigende Arbeitslosigkeit betraf viele Familien. In den Betrieben kam es 1969 zu spontanen Streiks, den »September-Streiks«.
Es gab Kritik am Bildungssystem. Eine Bildungsenquete stellte erhebliche Defizite fest. Die unteren Sozialschichten – insbesondere Arbeiterkinder – waren von höherer Bildung nahezu ausgeschlossen. Es war auch die Zeit, in der die Gesamtschule eingeführt wurde und zwar gegen heftige Widerstände. An den Universitäten rebellierten die Studenten. Sie zeigten ihre Solidarität mit den nationalen Befreiungsbewegungen in den ehemaligen Kolonien. Sie haben unkonventionelle öffentliche Provokationen angewandt. Zu den Betrieben und den Organisationen der abhängig Beschäftigten fanden sie leider meistens keinen nachhaltigen Zugang. In der Wissenschaft fand die Unruhe ihren Ausdruck in der Kritischen Theorie. Die Soziologie war das Kernfach der sich rasch ausbreitenden Studentenbewegung. Auch dort ging es um Gesellschaftskritik – insbesondere um Ideologiekritik.
Die Studentenbewegung war anti-autoritär. Ein bekannter Spruch lautete: »Unter den Talaren – Muff von 1000 Jahren«. Sie war anti-faschistisch. Die meisten von uns hatten heftige Auseinandersetzungen mit ihren Eltern, die mit dem Nationalsozialismus verbandelt waren. Und sie war anti-kapitalistisch. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) spielte eine führende Rolle.
Max Horkheimer prägte den Satz: »Wer vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen.« Im Zentrum der politischen Diskussionen stand der Vietnamkrieg, der 1973 zu Ende ging. Die Nationale Befreiungsfront jagte die USA aus Vietnam. Es gab zahlreiche Vietnam-Kongresse, die sich mit dem sich befreienden vietnamesischen Volk solidarisierten. Auch gab es 1973 eine weltweite Kritik an dem Sturz des gewählten sozialistischen Präsidenten von Chile, Salvador Allende (am 11. September 1973), bei dem die Chicago-Boys (also Ökonomen aus Chicago wie z.B. der Monetarist Milton Friedman) eine dunkle aber zentrale Rolle spielten. Zahlreiche kritische Chilenen wurden damals als Asylsuchende in die ganze Welt verstreut. Es gab große Sympathie für die »Nelken-Revolution« in Portugal. Sie stürzte den Autokraten Salazar, der nichts für Demokratie übrig hatte. Und nicht zu vergessen – besonders wichtig für Europa –waren die vielen solidarischen Aktionen gegen das Obristen-Regime in Griechenland von 1967–1974. Sie trugen mit zu dem Niedergang des autoritären Regimes bei und unterstützen die Wiedereinführung der Demokratie.
Es gab heftige Kritik an den USA (besser: an der US-Administration), da sie in alle Ereignisse aktiv verwickelt war – ein weiterer Schwerpunkt der us-amerikanischen Interventionen war Südamerika.
Kulturell war es eine Zeit der Rebellion und Emanzipation.
- Woodstock mit seinem Motto Love & Peace war ein Magnet für junge Leute (ca. 400.000 Besucher).
- Rock’n Roll, die Beatles und die Rolling Stones standen für eine kulturelle Revolution.
- Harry Belafonte: Der beliebte Calypso-Sänger aus der Karibik, war aktiv in der Schwarzenbewegung um Martin-Luther-King und politisch hoch engagiert.
- Und schließlich ist die sexuelle Liberalisierung nicht zu vergessen. Das Sexualleben der meist Jugendlichen hatte sich durch die Einführung der Kontrazeptions-Pille enorm verändert.
- Darüber hinaus startete eine Kampagne gegen das Abtreibungsverbot.
Das sind einige Farbtupfer aus der damaligen Zeit, die vielleicht dazu beitragen können, die Stimmung – den »Zeitgeist« – besser zu verstehen.
Was tat sich zu der Zeit im Gesundheitswesen?
Wegen der mangelhaften Krankenversorgung gab es zu dieser Zeit erhebliche Unruhe im Gesundheitswesen. Diese Unruhe explodierte regelrecht am Abend des 20. September 1970 in der Fernsehsendung »Halbgott in Weiß« und den daraus folgenden Ereignissen. Hans Mausbach, ein chirurgischer Assistenzarzt (2022 gestorben), sprach in dieser Sendung von:
- Klassenverhältnissen, Klasseninteresse und antidemokratischer Rangordnung im Gesundheitswesen;
- »Kampf um Laufbahn, Macht, Prestige und Geld wird auf Rücken von Patienten ausgetragen«;
- Experimenten an Menschen;
- kommerziellen Interessen;
- Gefälligkeitspublizistik für Pharmaindustrie.
Das waren klare Worte, die viele, die die Situation in den Krankenhäusern kannten, nachvollziehen konnten. Darauf folgte am nächsten Morgen die fristlose Entlassung durch seinen Chef, den Chirurgen Prof. Edgar Ungeheuer! Hans Mausbach war arbeitslos. Es folgte ein mehrjähriger Arbeitsprozess, den Hans schließlich gewonnen hat.
In der folgenden Zeit kam es zu einer Fülle von kritischen Aktivitäten im Gesundheitswesen.
1971 und 1972, den beiden Jahren vor dem Marburger Kongress, sah das so aus: 1971 veröffentlichte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Gewerkschaften seine viel diskutierte Studie »Die Gesundheitssicherung in der Bundesrepublik Deutschland, Analysen und Vorschläge zur Reform«. Bei den Vorschlägen ging es um das Modell einer »Integrierten Medizinischen Versorgung«. Im Mittelpunkt standen MTZ (Medizinisch Technische Zentren), die aus dem klinischen Alltag ausgegliedert werden sollten. Dies erregte in der ärztlichen Standespolitik besondere Aufregung, da die technischen Leistungen im Einkommen der Niedergelassenen besonders relevant waren. Ein Reizthema bis heute!
1971 startete die Kampagne: »Wir haben abgetrieben«. Dieses Bekenntnis von 374 prominenten Frauen wurde in der Zeitschrift Stern vom 6. Juni 1971 veröffentlicht. Die Selbstbezichtigungskampagne entfachte heftige Diskussionen um die Reform des § 218 im Strafgesetzbuch.
Im September 1971 kam es unter der Führung des Marburger Bundes zu einem berufsständischen Streik der Krankenhausärzte allein für ihre finanzielle Besserstellung sowie Überstunden, den Bereitschaftsdient und die Rufbereitschaft. Wenn es um ihre eigenen Interessen geht, können Standesorganisationen sehr radikal sein. Trotz alledem, war es Ausdruck für die Unruhe im Krankenhaus. Diese Kritik steigerte sich im Jahr 1972.
Im April/Mai 1972 erschien die 7‑teilige Spiegel Titel-Serie: »Das Geschäft mit der Krankheit«. Darin wurden vor allem die niedergelassenen Ärzte wegen ihrer Reformunwilligkeit kollektiv angeklagt. Die Mängel im System würden von den Standesvertretern verschleiert oder bagatellisiert. Die Kranken würden entmündigt und »auf den Kinderstatus zurückgeworfen«. Als Reformvorschläge werden Diagnostikzentren nach dem Vorbild der Mayo-Klinik in den USA diskutiert. Auch nach Schweden und Großbritannien wird der Blick gerichtet und die Bedeutung von Ambulatorien und Polikliniken betont. Und verwiesen wird auf einen Slogan protestierender Studenten: »An jedem 10. Klinikbett wird ein Ordinarius fett.«
Auf dem 75. Deutschen Ärztetag in Westerland vom 29. Mai bis 2. Juni 1972 kam es zu Tumulten. Delegierte kritisierten die selbstherrlichen Auftritte der Standesfunktionäre. Vor allem jüngere Delegierte verlangten, die Ärzteschaft möge sich mit der Beweisführung, den Zahlen und Statistiken der Spiegel-Serie sachlich auseinandersetzen. Sie wurden von der Mehrheit der meist angegrauten Ärztetags-Delegierten niedergeschrien oder ihnen schlug Hohngelächter entgegen, hieß es in der Presse.
Am 29. Juni 1972 wurde das Krankenhausfinanzierungsgesetz verabschiedet, das ob der desolaten Zustände an den Krankenhäusern überfällig war.
Im Landratsamt von Hanau wurde seit Ende der 60er Jahre das »Klassenlose Krankenhaus« geplant. Privatstationen sollten darin abgeschafft werden. Die Aufnahme ins Krankenhaus, die ärztliche Behandlung und Pflege sollen sich nur nach Art und Grad der Erkrankung und nicht nach dem sozialen Status richten. Weiter ging es um den Abbau der hierarchischen Strukturen. Das Chefarzt-System sollte durch demokratische Strukturen ersetzt werden. Die Privatliquidationen der leitenden Ärzte sind abzubauen, hieß es. Hohe Ansprüche, die allerdings nicht realisiert werden konnten. Es blieb bei der Diskussion.
Mitten hinein in die Diskussion um die Reform der ärztlichen Versorgung platzte 1972 das Gesundheitspolitische Programm des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) mit dem Titel »Ausbau von Vorsorge und Früherkennung«. Prävention war eine längst überfällige Forderung. Über die WSI-Studie hinaus war das die zweite gesundheitspolitische Intervention der Gewerkschaften in kurzer Zeit. Warum? Was haben Gewerkschaften mit Gesundheit zu tun? Gewerkschaften setzen sich vor allem für die Interessen der abhängig Beschäftigten im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen ein. Die abhängig Beschäftigten sind Sozialversicherte. Sie sind in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) pflichtversichert. Die Gewerkschaften erheben weiter den Anspruch in der GKV, in der es vornehmlich um die Finanzierung des Gesundheitswesens geht, die Interessen der Sozialversicherten zu vertreten.
Parallel zu dieser Unruhe gab es eine rege kritische Publikationswelle:
- Kritik der bürgerlichen Medizin in der Zeitschrift Das Argument. Aus der damaligen Redaktion sind Udo Schagen und Rolf Rosenbrock heute hier bei uns.
- Michael Regus publizierte den vielbeachteten Essay: »Das Krankenhaus im gesellschaftlichen Widerspruch«, in den Blättern für deutsche und internationale Politik.
- Alexander Mitscherlich: »Der Kranke in der modernen Gesellschaft«, 1967,
- Und schließlich das Buch von Josef Scholmer: »Krankheit der Medizin«, 1972
Die angegriffenen Ärztefunktionäre ließ dies alles nicht unberührt. Sie fürchteten eine – wie sie meinten – »Sozialisierung« der Medizin. Am 13. April 1972 veröffentlichten sie im Deutschen Ärzteblatt einen »Aufruf zum Handeln! Freiheit für Arzt und Patient in Gefahr!« Er richtete sich gegen die »Propagandahetze gegen die Ärzteschaft mit dem Ziel ihrer Sozialisierung« hieß es. Sie richteten zur Finanzierung einen »Kampf-Fonds« ein. Unterschrieben war der Aufruf von den führenden Standesfunktionären Fromm, Sewering, Muschalik, Voges, Schmitz-Formes und Stockhausen. Im Deutschen Ärzteblatt (Heft 9, 1972) hieß es schließlich: »Mit der Sendung ›Halbgott in Weiß‹ hat es angefangen, über die Veröffentlichung der WWI-Studie und die mehr als kritischen Reden auf dem Krankenkassentag war es weitergegangen. Die Spiegelserie über ›Das Geschäft mit der Krankheit‹ machte es dann in sechs (sieben d.V.) Folgen auch dem letzten Arzt klar. Das bisher hohe Ansehen seines Standes steht unter publizistischen Trommelfeuer.«
Wie ist es zu dem Kongress gekommen?
Auf diesem Hintergrund – der Disziplinierung von Hans Mausbach und den folgenden medizinkritischen Aktivitäten im Jahr 1972 – kam es dann zur Vorbereitung des Marburger Kongresses. Sie ereignete sich ganz konkret wie folgt:
Der Pahl-Rugenstein-Verlag (PRV) wollte angesichts der desolaten Situation im Gesundheitswesen ein kritisches Buch machen. Hans Mausbach, enfant terrible durch seine öffentlichen Auftritte, war arbeitslos und hatte seine chirurgische Weiterbildung nicht abschließen können. Der PRV hat ihn für dieses Buchprojekt eingestellt. Zu diesem Zweck trafen sich dann Paul Neuhöfer (PRV), der Psychiater Erich Wulff (Argument-Autor), Hans Mausbach und ich zu einer Besprechung im Arbeitszimmer von Erich Wulff in Gießen. Wir kamen zu der Überzeugung, dass unsere Kapazitäten für ein solides kritisches Buch über das deutsche Gesundheitswesen nicht ausreichten. Es sollte ein Kongress vorgeschaltet werden. Warum in Marburg? Ich war wissenschaftlicher Assistent im Soziologischen Institut der Philipps-Universität und kannte die politische Szene. Insbesondere zupass kam uns die gute politische Infrastruktur des Arbeitskreises Kritische Medizin (AKM) in Marburg, von dem auch heute hier noch einige Zeitzeugen anwesend sind.
Als nächstes stellte sich die Frage: Wer soll teilnehmen? Der Kongress sollte eine linke Sammelbewegung sein, möglichst viele Berufsgruppen aus dem Gesundheitswesen, inclusive der Studierenden. Und die unterschiedlichen politischen Gruppierungen sollten vertreten sein – vom KBW bis zur Sozialdemokratie. Selbst die ärztlichen Standesorganisationen waren als Gegenpol eingeladen. Also – eine bunte Mischung! Es ging uns nicht um eine Beschimpfung der Ärzte. Es ging uns um die Kritik am Gesundheitssystem und da sollten die Arztinnen und Ärzte einbezogen werden.
Von den Institutionen standen die Gewerkschaften im Mittelpunkt (DBG, ÖTV), die Kassen (GKV, Sozialversicherte), SPD (Landrat Woythal aus Hanau, Hans See), die Kommunalverwaltung.
Insgesamt ca. 1.800 Teilnehmer
Was waren die Hauptinhalte des Kongresses »Medizin und gesellschaftlicher Fortschritt« am 20./21. Januar 1973?
Es gab zwei Hauptreferate: Michael Regus sprach über »Kritik des Gesundheitswesens in der BRD« mit der Stoßrichtung gegen Standespolitik, für demokratische Berufspolitik. Und Alfred Schmidt sprach über das gerade erschienene Gesundheitspolitische Programm des DBG.
Von unserer Seite herrschte kritische Solidarität mit den Gewerkschaften. Was heißt das? Es gab rechte (z.B. Chemie, Bau) und linke (z.B. Metall, Medien) Gewerkschaften. Auch innerhalb der Gewerkschaften gibt es rechte und linke politische Positionen. Unsere Sympathie galt den linken Gewerkschaftsinhalten.
Insgesamt ging es um Medizinkritik und die Hauptkritikpunkte waren:
- Vernachlässigung der psychosozialen Dimension in der Medizin,
- Vernachlässigung der Prävention: unter 1% der Gesundheitsausgaben der BRD wurden für Prävention (dann meist für Früherkennung) ausgegeben; der Begriff der Gesundheitsförderung wurde erst später geprägt.
- Gefordert wurde eine Psychiatrie-Reform in Richtung einer Sozialen Psychiatrie; Gründung der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP) (1970), internationale Psychiatriebewegung (Basaglia etc.);
- Kritik der Arbeitsmedizin;
- Forderungen: verstärkte Demokratisierung medizinischer Institutionen; mehr Mitbestimmung am Arbeitsplatz und bei Planung;
- Wir sprachen von gewerkschaftlicher Orientierung: d.h. Parteinahme für die Sozialversicherten, für die abhängig Beschäftigten und vor allem für die Patienten als Subjekte. Das Eintreten für die gewerkschaftliche Orientierung und die Sozialversicherten war für uns Ausdruck der Klassenfrage.
- Wir waren gegen die Kommerzialisierung in der Medizin. Ansätze dafür sahen wir im Belegarztsystem, der Privaten Krankenversicherung, der Pharmaindustrie, die niedergelassenen Ärzte als Unternehmer, die in der Spiegel-Serie heftig kritisiert wurden.
- Wir waren gegen ärztliche Standespolitik, in der wir den geballten Gruppenegoismus zur Sicherung ärztlicher Privilegien sahen;
- Wir starteten einen Aufruf für eine »alternative, soziale und demokratische Berufspolitik« (Kongressbericht S. 74). Es war der Startschuss für die Liste Demokratischer Ärzte, die 1976 dann erstmals in Hessen zur Wahl antrat.
Die Resonanz in Presse war groß: Die Standesorganisationen haben getobt: Nestbeschmutzer, Revolutionäre Traumtänzer, geht doch nach drüben. Die hatten Schaum vor dem Mund!
Zum Schluss: Ein Sprung in die Gegenwart
Seitdem ist eine lange Zeit vergangen. Die Welt von 2023 ist 50 Jahre danach eine andere. Was unterscheidet uns heute von damals? Eine Vielzahl von Krisen belastet die Gesellschaften weltweit. Die globale Gesundheit leidet unter der Bedrängnis vieler alter und neuer Gefahren. Am stärksten leidet sie unter anhaltenden Kriegen und bewaffneten Konflikten. Nach wie vor hat die Behandlung und Versorgung von Kranken Klassencharakter. Die aktuelle Inflation mit steigenden Lebensmittelpreisen hinterlässt ihre Spuren. Besonders betrifft sie die Ärmsten. Die globale Gesundheit leidet unter einer sich zuspitzenden Bedrohung durch die Klimakatastrophe und die Nachwirklungen der Covid-19-Pandemie. Der Aufschwung autoritärer Regime und der fortgesetzte neoliberale Umbau höhlen in vielen Staaten die Sozialsysteme aus. Der auslaufende Neoliberalismus ist die Hauptursache der weltweiten »Care«-Krise, die durch Migration von einem Land ins andere verschoben wird. Der Neoliberalismus hat nicht zuletzt die Versorgung von Kranken zur ökonomischen Ware oder rentablen Dienstleistung gemacht. Die Kommerzialisierung der Krankenversorgung ist eine von Menschen gemachte Katastrophe!
Angesichts dieser Situation brauchen wir ein gesundheitspolitisches Forum, das sich nicht scheut, diese Situation wissenschaftlich aufzudecken und kritisch – bis an die Wurzeln des Gesellschaftssystems – zu hinterfragen. Die radikale Analyse ist letztlich die Voraussetzung für eine nachhaltige Verbesserung der Gesundheitsförderung und der Krankenversorgung. Darüber hinaus brauchen wir eine gesellschaftskritische Bewegung, die sich mit den demokratischen Kräften an der konkreten Umsetzung einer solchen Gesundheitspolitik aktiv beteiligt.
Die Kritische Medizin hat dafür seinerzeit die Richtung angedeutet. Der Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte hat sie politisch vertieft und erweitert. Und ich bin zuversichtlich, dass der VDÄÄ* auch weiter an diesen Zielen festhält, denn er wird seine Vergangenheit nicht verleugnen wollen.
November 2023
Hans-Ulrich Deppe ist Medizinsoziologe und Sozialmediziner, er war bis 2004 Direktor des Instituts für Medizinische Soziologie an der Goethe-Universität Frankfurt/Main; er ist Gründungsmitglied des vdää* und bis heute im erweiterten Vorstand.
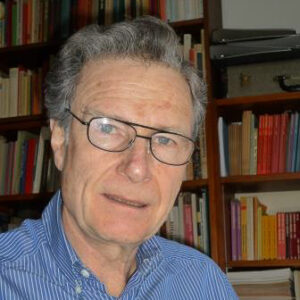
Der Kongress ist dokumentiert in H.-U. Deppe u.a. (Hrsg.): Medizin und gesellschaftlicher Fortschritt, Köln 1973. Der Band ist antiquarisch erhältlich.







