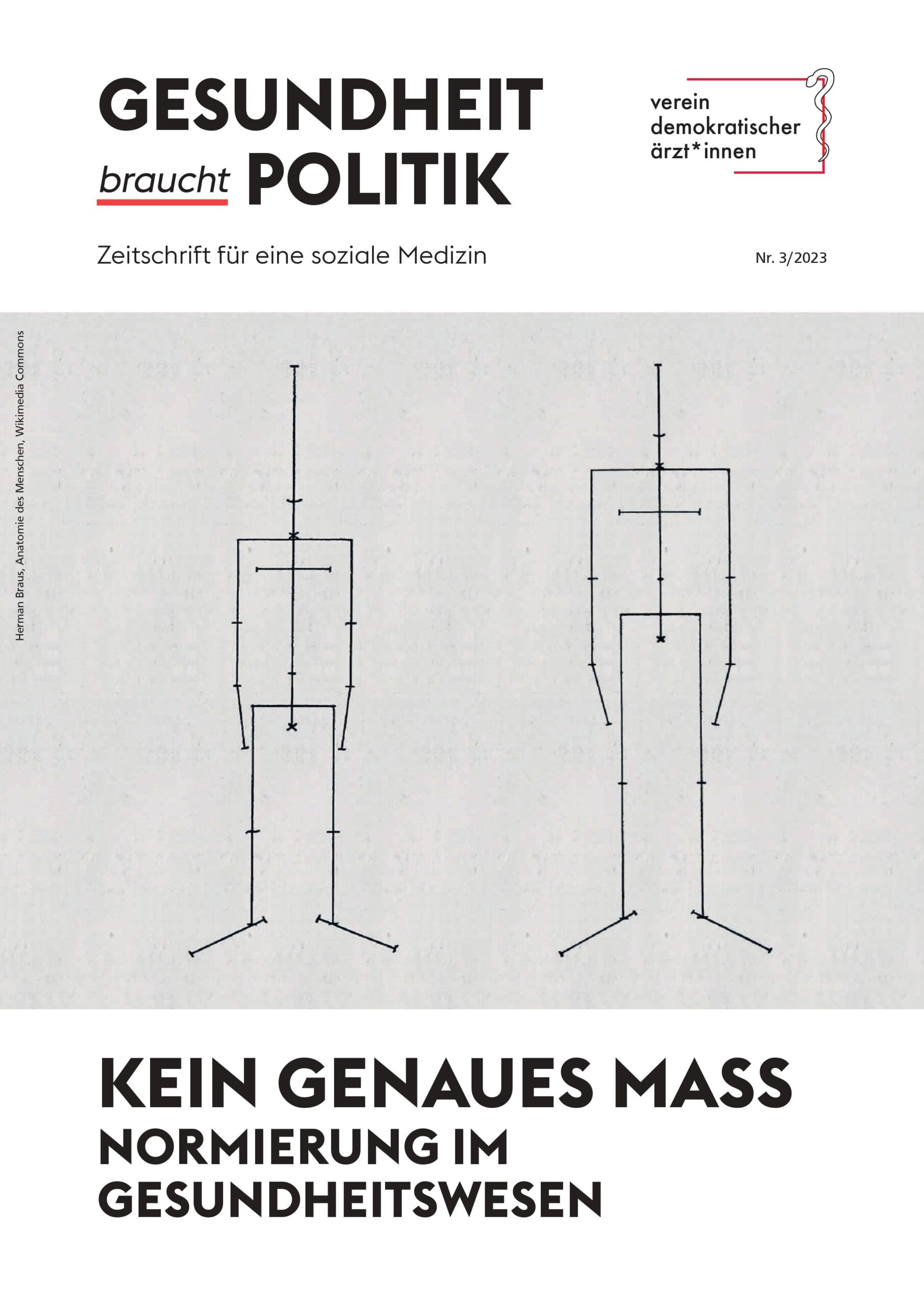aus der Gesundheit braucht Politik 3/2023
von Hagen Kühn
Hagen Kühn stellt uns hier die Geschichte der Kritischen Medizin vor und diskutiert dabei auch, wie die Medizin(er*innen) an der Setzung und Durchsetzung von Normen in einer kapitalistischen Gesellschaft beteiligt sind. Es handelt sich um eine von der Redaktion stark gekürzte Fassung des ursprünglich 2013 veröffentlichten Textes.1
1.
Der Begriff ›Kritische Medizin‹ entwickelte sich in der Studentenbewegung der 1960er und 1970er Jahre. Vorläufer waren studentische »Arbeitskreise kritische Medizin«, die sich 1968 an vielen medizinischen Fakultäten zusammengefunden hatten. KM ist kein konsistentes theoretisches Konzept wie die ›Kritische Psychologie‹, sondern eher eine Sammelbezeichnung für linke, zunächst meist am Marxismus orientierte Kritik an der Medizin und den gesellschaftlichen Bedingungen von Gesundheit und Krankheit. In Deutschland artikulierte sich KM ab 1970 vorwiegend um die Zeitschrift »Das Argument« mit Veröffentlichungsreihen: »Zur Kritik der bürgerlichen Medizin«, »Argumente für eine soziale Medizin«, aus denen das seit 1976 zweimal jährlich erscheinende »Jahrbuch für kritische Medizin« (JKM) (seit 2009 mit dem Zusatz:«und Gesundheitswissenschaft«) hervorgegangen ist. Im englischsprachigen Raum werden vom »International Journal of Health Services« ähnliche Positionen vertreten.
Implizit versteht KM Kritik von Beginn an nicht im Sinne des (negativen) Urteilens, sondern als Teil gesellschaftsverändernder Praxis. Anders als die einschlägigen Fachwissenschaften, will KM mehr als nur Materialen liefern für Verwendungszwecke im Rahmen bestehender Herrschaftsverhältnisse, sondern diese selbst sollen zum Gegenstand kritischer Wissenschaft werden. Selbst spezielle Themen sollen in einer herrschaftskritischen und emanzipatorischen Perspektive mit – zumindest implizitem – Bezug auf den kapitalistisch-warengesellschaftlichen »Verstrickungszusammenhang« (Adorno) analysiert werden. Frei zur Gesundheit sind für KM die Menschen nur, soweit sie individuell und kollektiv frei über deren Bedingungen verfügen können.
| 2. |
In ihrer Entstehungszeit konnte KM an mehrerer historische Traditionen anknüpfen, die durch den Nazismus gewaltsam abgebrochen worden waren: (1) die Gesundheits- und Krankenversicherungspolitik der Arbeiterbewegung (Milles 2005), (2) die Bewegung sozialistischer Ärzte in der Weimarer Republik (Deppe 1987), die Geschichte der Sozialhygiene bzw. Sozialmedizin (Schagen, Schleiermacher 2005) und nicht zuletzt an die umfangreichen empirischen Arbeiten von Engels und Marx zur ›industriellen Pathologie‹ (HKWM).
KM und die in den 1970ern entstehenden Initiativen demokratischer und gewerkschaftlicher Ärzte waren eng verbunden. Autoren der KM spielten 1973 bei der Ausrichtung des Kongresses »Medizin und gesellschaftlicher Fortschritt« in Marburg eine bedeutende Rolle (Deppe et al. 1973). Davon sind wichtige Impulse auch auf Gewerkschaften und Sozialdemokraten ausgegangen, ihre traditionelle Rolle der Mitverwaltung der gesetzlichen Krankenversicherung zugunsten humanisierender Mitgestaltung zu überwinden.
Obwohl ein Großteil der Autoren Sozialwissenschaftler waren, dominierten – wie auch auf dem Marburger Kongress – in den ersten Jahrzehnten ärztliche Themen. Das korrespondierte mit der Tatsache, dass gewerkschaftliche und demokratische Ärzte eine offensive und letztlich auch erfolgreiche Oppositionsbewegung gegen die konservativen und (damals) reaktionären ärztlichen Standesorganisationen und deren Allmacht in den öffentlich-rechtlichen Kammern vorangetrieben hatten. Der ›Bund gewerkschaftlicher Ärzte‹ stiftete in der Gewerkschaft ÖTV viel potentiell produktive Unruhe und in den Krankenhäusern regte sich erstmals Widerstand gegen den autoritären Medizinbetrieb.
Ende der 1970er Jahre zeichnete sich der Beginn einer Art kopernikanische Wende in der Sichtweise auf die Gesundheit ab, die bis heute nicht abgeschlossen ist. Bis dahin war ›gesundheitlicher Fortschritt‹ selbstverständlich gleichgesetzt worden mit ›(bio)medizinischem Fortschritt‹. Es dominierte – auch auf Seiten der KM – die Meinung, die Medizin sei, wenn nicht der einzige, so doch der wichtigste und entscheidende Faktor für Gesundheit und Lebenserwartung. Aber ebenso wie um 1970 die Grenzen des Glaubens, die zentralen Menschheitsprobleme ließen sich durch Innovationen in Naturwissenschaft und Technik lösen, sichtbar wurden, geschah das auch im Hinblick auf die Medizin. Hier wie dort gerieten zunächst die »Grenzen des Wachstums« ins Blickfeld.
Viele erkannten oder ahnten, dass Naturwissenschaft und Technik als Grundelemente des industriellen Wachstums geistige Ausdrucksformen der vom Kapital als Akkumulationsprozess organisierten Mensch-Natur-Beziehung sind. Und es war nicht weit zur Einsicht (oder zumindest zur Vorahnung), dass die technisch-pharmakologische Biomedizin integraler Bestandteil dieser Beziehung ist. Es vermischte sich Skepsis gegenüber dem bislang Selbstverständlichen mit einer Aufbruchsstimmung.
Mit bislang unbekannter Dynamik erhob sich unter den Gesundheitsberufen und bei vielen chronisch kranken Bürgern Kritik und Opposition gegen die – wie es hieß – »naturwissenschaftlich bornierte« Medizin und es begann die Suche nach alternativen Heil- und Versorgungsformen. Es sollte sich noch erweisen, dass selbst der naturwissenschaftliche Anspruch der Medizin, nicht eingelöst wird.
Bemerkenswert aus heutiger Sicht ist, dass die oppositionellen und die alternativen Strömungen der Gesundheitsbewegung zunächst noch zusammengingen. Höhepunkte waren die ›Gesundheitstage‹ der 1980er Jahre. Zum ersten Gesundheitstag 1980 in Berlin kamen mehr als 10.000 Teilnehmer. Dies wurde in Hamburg 1981, Bremen 1983 und Kassel 1987 mit noch wachsenden Teilnehmerzahlen fortgesetzt (Deppe 1987, 151–215). Auch die damals starke westdeutsche Friedensbewegung hat den Gruppen und Subkulturen der Gesundheitsbewegung oppositionelle Impulse gegeben. KM hat diese Prozesse begleitet und die zunehmend individualisierenden, antipolitischen und erklärt irrationalen Tendenzen der Alternativbewegung kritisiert (Schagen/Göbel 1982; Kühn 1989). Zwei wesentliche Wendungen in der gesundheitspolitischen Linken sind das bleibende Resultat dieser Jahre: die Menschen werden stärker als Subjekte des präventiven und therapeutischen Handelns wahrgenommen und sowohl die Gesundheit als auch die Medizin werden auch aus einer ökologischen Perspektive betrachtet.
| 3. |
Mit der weltweiten neoliberalen Wende und dem davon ausgehenden Druck auf Arbeitsbedingungen, Beschäftigungssicherheit, Löhne und Sozialstaat wurde in den 1980er Jahren die Entscheidung zwischen dem alternativen Sich-Einrichten im Gegebenen und der oppositionellen Gegenwehr immer unausweichlicher. KM verstand sich als Teil der oppositionellen Gesundheitsbewegung. Fragen nach Reichtum und Armut, Gesundheit und Krankheit, Mensch-Natur-Beziehung und nachhaltiger Gesellschafts- und Produktionsentwicklung sowie der Gestaltung von Lebens- und Arbeitsbedingungen nach dem Maß menschlicher Fähigkeiten und Bedürfnisse werden im Zusammenhang gesehen. Weltweiter gesundheitlicher Fortschritt setzt voraus, dass die Menschen sich bei der Erarbeitung ihrer Lebensvoraussetzungen in grundsätzlich anderer Weise zur Natur ins Verhältnis setzen müssen, und zwar sowohl zur ›äußeren‹ Natur als auch zu sich selbst als Naturwesen.
Damit stellt KM die Medizin nun nicht mehr nur in ihren Versorgungsformen, sondern auch in ihren Inhalten in Frage. Denn die Mensch-Natur-Verhältnisse zur inneren und äußeren Natur sind interdependent. Der kapitalwirtschaftlich betriebenen Verwertung der Natur entspricht die Ökonomie der Arbeitskraft, dem Naturschutz der Arbeitsschutz. In diesem Kontext ist die naturwissenschaftlich-technische Medizin einerseits ein Produkt der Industriegesellschaft und reproduziert andererseits das industriegesellschaftliche Muster der Naturbeziehung gegenüber dem Naturwesen Mensch. Auch das enorme Maß der Exklusivität, in dem die Biomedizin für die Bearbeitung der Fragen von Krankheit und Gesundheit als »zuständig« angesehen wird (s.u.), und die Selbstverständlichkeit, mit der dies der Fall ist, entspricht dem industriegesellschaftlich halbierten Rationalismus, der Fragen nach seiner Beziehung zu den räumlich-zeitlichen, sozialen und ökologischen Grundlagen der Menschheitsentwicklung nicht stellt.
Für die KM ist daher – ohne dass Fragen einer humanen Medizin und deren Finanzierung für die gesamte Bevölkerung vernachlässigt wurden – die Verhinderung von Krankheiten (Prävention) und die Förderung salutogener Bedingungen (Gesundheitsförderung) zum Hauptfeld geworden. Zugleich wurde – mit dem Engagement auch von Autoren der KM – im akademischen Betrieb die Entwicklung des Faches Public Health (Gesundheitswissenschaften) vorangetrieben.
Zeitgleich mit dieser Entwicklung verliert die KM allmählich an oppositioneller gesellschaftskritischer Energie. Das ist insofern kein Wunder, als diese den intellektuellen Bemühungen historisch immer nur dann zugewachsen ist, wenn sie Bestandteil einer umfassenderen systemoppositionellen politischen Bewegung waren. Mit der Krise und partiellen Domestizierung der Linken in den 1990er Jahren lässt sich auch im Jahrbuch für kritische Medizin eine allmähliche Abkehr vom (meist impliziten) Bezug zur Gesellschaftskritik zugunsten einer stärkeren fachwissenschaftlichen Ausrichtung an der neuen akademischen Disziplin Public Health/ Gesundheitswissenschaft beobachten.
| 4. |
KM ist einem emanzipatorischen Verständnis von Gesundheit verpflichtet und steht damit gegen den herrschenden und praktizierten Gesundheitsbegriff. Das Gesundheits- und Krankheitsverständnis verändert sich nicht nur in unterschiedlichen historischen und kulturellen Kontexten, sondern auch innerhalb einer Gesellschaft, je nach Bezugssystem, Status und Interessenlage.
Im Zuge der Rationalisierung des individuellen Habitus nahm die Gesundheit der Arbeitenden auch den Charakter einer Pflicht an, und Krankheit erhielt die Konnotation von falsch gelebtem Leben, also von moralischer Schuld. Zugleich delegierte die Gesellschaft Fragen von Gesundheit und Krankheit mehr und mehr an die mit der Industrialisierung neu entstehende, vom Anspruch her naturwissenschaftlich-technische Medizin.
Das Ideal von Gesundheit ist seither ständigem Wandel unterworfen, hat aber seinen herrschaftlich-administrativen Charakter nicht verloren. Ebenso wie das Bild vom idealen Arbeitnehmer und Staatsbürger im kybernetischen Zeitalter nicht mehr das ›Rädchen im Getriebe‹ der Industriegesellschaft ist, sondern eher das ›sich selbstoptimierende‹ Individuum, dem seine Pflicht zur »Eigenverantwortung« herrschaftlich entgegengehalten wird, enthält auch ›Gesundheit‹ in der Konsumgesellschaft weniger asketische Konnotationen, sondern wird tendenziell gleichgesetzt mit »Fitness« im Sinne von optimalem Angepasstsein an Aufgaben, Konkurrenz und Normalität (›Fit‹ wird im Dictionary mit »passend, geeignet, tauglich« übersetzt). Wo Individualisierungstendenzen, Konkurrenz und konsumistischer Wohlstand zusammenwirken, kann dies in ›Healthismus‹, in die Verselbständigung des Gesundheitsstrebens umschlagen, d. h. in die habitualisierte ständige Sorge um und Befassung mit der persönlichen Gesundheit im Sinne auch von sicht- und vorzeigbarer Fitness (Kühn 1993).
Rechtlich-administrativ ist die Definition von Gesundheit in die Hände der Ärzte gelegt und wird de facto mit dem Fehlen von Krankheitssymptomen identifiziert. Der Medizin sind durch das Definitionsmonopol Hoheitsaufgaben zugewachsen: Sie entscheidet nach ihren Kriterien über Rechtsansprüche, wie die auf bezahlte Nichtarbeit (›Arbeitsunfähigkeit‹), Militäruntauglichkeit, vorzeitigen Rentenbezug, sozial- und auch privatrechtliche Leistungsansprüche aufgrund von Krankheit und Behinderung oder auch verminderter Schuldfähigkeit.
Konträr dazu verbindet KM Gesundheit mit der humanistischen Perspektive der Emanzipation und Freiheit. Gesundheit ist ebenso wenig individuelle Verhaltenspflicht wie Krankheit Schuld ist. Sondern sie liegt im eigenen Entwicklungsstreben der Individuen, die aber nicht über die Voraussetzungen ihrer Gesundheit verfügen (können) und daher ist diese auch Anspruch an die Gesellschaft, diese Voraussetzungen zu schaffen und die Möglichkeit, individuell und gesellschaftlich darüber zu verfügen. In diesem Sinne – abhängig auch vom Reichtum, Produktivität und wissenschaftlichen Stand der Gesellschaft, also historisch-relativ – ist Gesundheit Menschenrecht. Es sollte für jedes Individuum gleichermaßen gelten, ebenso wie das Recht der Kranken auf solidarische und historisch-mögliche Hilfe. Die viel gescholtene Definition der Weltgesundheitsorganisation von 1947 steht im Gegensatz zur herrschaftlich-administrativen Gesundheit. Sie sieht in ihr einen »Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen«. Sie öffnet den Horizont für das emanzipatorische Verständnis von Gesundheit, aber verbleibt im Reich der Idee und schweigt sich aus über die Voraussetzungen und die gesellschaftliche Dynamik ihrer Realisierung.
| 5. |
Mit dem Schritt, die »körperliche Organisation« mit der Geschichte des »wirklich lebenden Menschen« ins Zentrum zu stellen, wird eine Freiheitsperspektive, der Zusammenhang von Gesundheit und Emanzipation sichtbar. Freiheit ist bei Marx nicht Auswahlfreiheit, sondern »sinnliche Aneignung des menschlichen Wesens« (40/539), individuelle und kollektive Verfügung über die eigenen Lebensbedingungen. Noch bezogen auf das Gattungswesen formuliert Marx eine implizite Gesundheitsutopie im Sinne des Menschenmöglichen. Sie wird real, wenn »der Mensch« in der Lage ist, sich »sein allseitiges Wesen auf eine allseitige Art« anzueignen, die »jedes seiner menschlichen Verhältnisse zur Welt« umfasst. Das sind »Sehn, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen, Denken, Anschauen, Empfinden, Wollen, Tätigsein, Lieben, kurz, alle Organe seiner Individualität, wie die Organe, welche unmittelbar in ihrer Form als gemeinschaftliche Organe sind« (40/539 f.). Diese menschenmögliche Gesundheit ist ein Kind der Freiheit. Umgekehrt formuliert Marx: »Was ist jede Krankheit als in seiner Freiheit gehemmtes Leben?« (1/59).
Marmot (2004), einer der international führenden Sozialepidemiologen, sieht die Emanzipationsperspektive von den international vorliegenden empirischen Forschungsergebnissen bestätigt. Das Fazit seiner Analyse zur Frage nach den Bedingungen, die bislang zu bester Gesundheit und höchster Lebenserwartung geführt haben lautet: »Autonomy, how much control you have over your life – and the opportunities you have for full social engagement and participation are crucial for health, well-being, and longevity« (ebda, 2).
| 6. |
Die Gesundheitswissenschaften definieren gesundheitsrelevante Lebensbereiche, messen, beschreiben und sortieren sie. Aber sie erfassen nicht ihre Dynamik und die von ihr angetriebenen Tendenzen und Widersprüche. Dazu wären die untersuchten Realitätsausschnitte zum Kapitalprozess in Beziehung zu setzten, aus dem die Gesellschaft ihre Dynamik bezieht, nicht als Ersatz für Empirie, aber zu ihrer Verarbeitung. Die Beziehung der Menschen zur menschlichen wie zur ›äußeren‹ Natur ist überwiegend als Verwertungsprozess von Kapital organisiert und selbst wo sie das nicht ist, davon beeinflusst. Die Kritik der gesundheitsrelevanten gesellschaftlichen Felder muss also darauf bezogen sein:
6.1
Die »wirklichen Individuen« arbeiten und leben in einer vom Kapitalprozess dominierten Gesellschaft. Die Mittel zur Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse sind zunehmend warenförmig und können nur mit Geld erworben werden. »Um ein rationeller Konsument der Ware der Kapitalisten zu werden, muss er [der Arbeiter, hk] vor allem (…) damit beginnen, seine eigene Arbeitskraft irrationell und gesundheitswidrig von seinem eigenen Kapitalisten konsumieren lassen« (24/511).
Der Mensch als Person und als »ein leibliches, naturkräftiges, lebendiges, wirkliches, sinnliches, gegenständliches Wesen« (40/578) wird zum Gegenstand der kapitalwirtschaftlichen Rechnungsführung. Diese kennt nur die Kriterien ›mehr‹ und ›weniger‹, aber kein ›Genug‹, keine Qualität, Moral oder Gesundheit. Niemals können Kosten zu niedrig sein und niemals der Profit zu hoch.
Die Herrschaft des Verwertungsinteresses über die Arbeitskraft ist also zugleich Herrschaft der Gleichgültigkeit über die »sinnlichen Aneignung des menschlichen Wesens«, der Entwicklung aller Sinne und Fähigkeiten, die in der »Leiblichkeit der lebendigen Persönlichkeit existieren« und mit denen der Mensch sich zur Welt ins Verhältnis setzt. Somit ist – strukturell – der Verwertungsprozess des toten Kapitals zugleich Entwertungsprozess des Menschen und damit auch seiner Gesundheit. Konkrete Interventionen können nur effektiv sein, wenn sie dieser Tendenz entgegenwirken.
Da die Verwertungslogik kein »Prinzip der Selbstbeschränkung« (Gorz) kennt, muss ihr das ›Genug‹ nach Kriterien der menschlichen Entwicklung von außen aufgenötigt werden. Nur die Lohnarbeiter selbst (als innere ›Außen‹), können dies tun. Sie müssen individuell und kollektiv handlungsfähig sein, um die Verfügung über die Bedingungen ihres Menschseins zu erweitern. Handlungsfähigkeit (»autonomy« und »full social engagement and participation« s.o.) ist Voraussetzung der gesundheitlichen Freiheitsperspektive, muss aber zugleich auch in der darauf gerichteten »eigene Aktion erzeugt« werden (MEW 3:20, Deutsche Ideologie).
6.2
Die Unterwerfung unter die Verwertungsimperative beschränkt sich nicht auf den Produktionsprozess. Das Leben der vom Lohn abhängigen Menschen ist bereits vor, während und nach der Arbeit »in seiner Freiheit gehemmt« durch die existentielle Angewiesenheit auf die Chance, überhaupt unter diesen Apparat subsumiert zu werden bzw. zu bleiben. Bereits hier müssen sie sich als Bestandteil ihrer Ware Arbeitskraft »verbiedern« (Anders 1983: 122), sich auf die Bedürfnisse des Käufers zurichten, sich fit machen. »Die persönliche Würde (wird) in den Tauschwert aufgelöst« (MEW 4: 465). Während also Handlungsfähigkeit Voraussetzung der (biopsychosozialen) Reproduktion der Lohnabhängigen ist, ist ihre Hemmung, die Verbiederung, Voraussetzung des Arbeitsverhältnisses. Dieser Widerspruch ist ein unverzichtbarer theoretischer Bezugspunkt für KM.
6.3
Die der Verwertungslogik folgende Produktion ist nicht nur gleichgültig gegen den Menschen als Naturwesen, sondern auch gegenüber seinen natürlichen Lebensbedingungen. Der »Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur« (MEW 23: 57), der als Kapitalverwertungsprozess organisiert ist, ist einzelwirtschaftlich borniert. Kosten und Schäden, die externalisiert werden können, sind für die Kostenrechnung nicht existent, aber die Rückwirkungen als Folge von Schadstoffen, Strahlungen, Abwasser oder Abluft beeinträchtigen Lebensqualität und Gesundheit und gefährden das menschliche Leben auf der Erde.
6.4
Eine weitere Ebene ist die Qualität des sozialen Zusammenlebens. Der homo oeconomicus ist nicht bloß ein Hirngespinst der bürgerlichen Ökonomen, sondern das der Marktkonkurrenz immanente Sozialisationsprogramm. Die Gesundheitsforschung bringt seit Jahrzehnten immer neue und methodisch bessere Studien hervor, die zeigen, dass Menschen, die dauerhaft spürbare Solidarität (›social support‹) erfahren gesünder und länger leben.
| 7. |
Zahllose Studien weisen in den reichen Ländern einen hochsignifikanten positiven und graduellen Zusammenhang nach zwischen der relativen Lohnhöhe und der Gesundheit bzw. Lebenserwartung.
Die ›Verkörperlichung‹ der je historisch konkreten Klassenverhältnisse ist, soweit sie nicht gewaltförmig ist, über den Habitus, das individuelle System verinnerlichter Wahrnehmungs‑, Bewertungs- und Handlungsmuster vermittelt. Die darin enthaltenen »Dispositionen der Unterordnung« nehmen oft die »Form einer körperlichen Empfindung an. »Scham, Schüchternheit, Ängstlichkeit, Schuldgefühl« (Bourdieu 2001: 215) sind das Gegenteil von Selbstachtung, sie sind »in seiner Freiheit gehemmtes Leben« (MEW 1: 59). Man hat zahlreiche psychobiologischen Prozesse ermittelt, mit denen solche – negativen wie positiven –Empfindungen ›unter die Haut‹ gehen und sich pathogen oder salutogen auswirken (vgl. Siegrist/ Marmot 2008).
| 8. |
KM ist auch Kritik des Medizinsystems und der Medikalisierung gesellschaftlicher Probleme. Im Blick standen in den 1960er und 70e Jahren überwiegend die ärztlichen Standesinteressen (Wulff 1971), die Pharmazeutische Industrie und andere industrielle Zulieferer (Ripke 1971), die Psychiatrie (Wulff 1972), hinzu trat dann die Kritik der inhaltlich-praktischen medizinischen Irrationalitäten (z.B. Abholz 1979, 2002), ebenso wie die tendenziell zunehmende Überformung der biomedizinischen Handlungslogik durch den Warencharakter der entsprechenden Dienstleistungen (Kühn 2004).
Der Begriff der »Medikalisierung« meint die Tendenz, immer mehr soziale Lebensprobleme der theoretischen, praktischen und ideologischen ›Zuständigkeit‹ der technisch-pharmakologischen Biomedizin zu überantworten und die »transformation of human conditions into treatable disorders« (Conrad 2007). Das gesellschaftliche Gewicht des expandierenden ›Medizinisch-industriellen-Komplexes‹ aus Leistungsanbietern, Wissenschaftsbetrieb, Zulieferindustrien, Wellness-Industrie etc. basiert weniger auf unmittelbarer Machtentfaltung, als auf der »Fähigkeit des Medizinsystems, gesellschaftliche Probleme in die ›Sprache‹ der Warengesellschaft, in individuelle Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen zu übersetzen, seien es Therapien, Arzneimittel, Diäten oder Sportgeräte. Bedürfnisse nach Entlastung vom Arbeitsdruck werden zur Nachfrage nach Beruhigungsmitteln, das Verlangen nach guter Atemluft verstärkt die Nachfrage nach Wellness-Aufenthalten. Potentielle politische Gestaltungsprobleme werden zu leicht lösbaren und profitablen warenwirtschaftlichen Versorgungsproblemen« (Kühn 1993: 177 f.).
Die Medikalisierung ist auch für die Individuen attraktiv: Sie können auf Problemlösungen hoffen, ohne sich und ihre soziale Umwelt verändern zu müssen. Das implizite Nutzenversprechen der technisch-pharmakologischen Medizin ist die warenförmige technische Lösung. Mittels Medikamenten, Substituten oder Operationen wird das pathogene Agens aus dem unveränderten Zusammenhang, dem Körper in seinen sozialen Bezügen, entfernt. Und je mehr Entsolidarisierung der Gesellschaft, Verarmung großer Bevölkerungsgruppen, soziale Unsicherheit und Mobilitätsdruck den schädigenden Stress erhöhen, desto bedeutender werden diese Lösungsversprechen für die Individuen.
| 9. |
Andererseits sind die Gesundheitsausgaben überwiegend Bestandteil des gesellschaftlichen Reproduktionsfonds der Arbeitskraft, der Summe von Löhnen, sozialen Geldleistungen und kostenlos in Anspruch genommenen öffentlich finanzierten Diensten und Infrastrukturen. Vorwiegend durch Budgetierung und ›Wettbewerb‹ wird Ökonomisierungsdruck auf die Versorgungseinrichtungen ausgeübt. Versorgungshandeln wird für diese zum ökonomischen Risiko und muss daher quantifiziert, standardisiert, kalkuliert und kontrolliert werden. Indem dies gelingt wird Medizin reif für die kapitalistische Landnahme. Auch in nicht kommerziellen Einrichtungen wird Medizin der kapitalwirtschaftlichen Handlungslogik unterworfen. Damit werden die »medizinischen und pflegerischen Entscheidungen, Therapien, Empfehlungen usw. tendenziell überformt durch das ökonomische Vorteilskalkül und die entsprechende Qualität der Beziehung zwischen Ärzten bzw. Behandlungsteams und Patient« (Kühn 1994: 26). Das »nackte Interesse« (4/465) bringt die Medizin in Konflikt mit ihren eigenen wissenschaftlichen und moralischen Ansprüchen, mit den Erwartungen der Bevölkerung (Kühn 2007) und den Interessen ihrer Beschäftigten. Die Ökonomisierungsprozesse lösen ihren ständischen Charakter auf. Die Ärzteschaft wird tendenziell polarisiert in eine Minderheit von Unternehmern und Managern, eine Mehrheit lohnabhängiger Dienstleister und eine schrumpfende freischaffende Mittelschicht.
Wenn die Freiheit der Medizin darin besteht, Medizin zu sein, also die gesundheitliche Lebensqualität gesunder wie kranker Menschen zu verbessern, dann ist sie doppelt unfrei: zum einen ist sie erwerbswirtschaftlich entfremdet und wird zunehmend Mittel zum geschäftlichen Zweck und zum anderen verhält sie sich bis in die tiefsten Annahmen ihrer wissenschaftlichen Konzepte hinein, opportunistisch nach Maßgabe ihrer Position im Herrschaftsgefüge der Gesellschaft. Diese Widersprüche zu analysieren und praktisch zu wenden ist Anspruch der KM.
Die biomedizinische Hegemonie gegenüber Konzepten sozialer Prävention und Gesundheitsförderung ist weiterhin ungebrochen. Sie ist zu tief in den Strukturen der Warengesellschaft verankert, als dass sie Schaden hätte nehmen können durch wissenschaftliche Erkenntnisse, die ihre Rolle bei der Verbesserung der Gesundheit stark relativiert haben. McKeown (1976) konnte in seiner bahnbrechenden Studie nachweisen, dass der weitaus größte Teil des Sterblichkeitsrückgangs im 19. und 20. Jh. bereits stattgefunden hatte, bevor wirksame Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten entwickelt waren und eingesetzt wurden. Als entscheidend erweisen sich Lebensweise und Lebensbedingungen. Waren diese bei McKeown noch stark auf Ernährung und Hygiene reduziert, so verweist die neuere sozialepidemiologische Forschung (zusammengefasst bei Wilkinson 2005, Marmot 2004, Siegrist/Marmot 2008) auf die sozialen Beziehungen, in denen die »wirklichen Menschen« (Marx) arbeiten und leben. Im Einklang mit dem gesundheitswissenschaftlichen Erkenntnisstand sieht KM die entscheidende Voraussetzung für gesundheitlichen Fortschritt in der Stärkung sozialer Oppositionsbewegungen zur Humanisierung der Arbeits- und Lebensbedingungen, für Solidarität und erlebbare Demokratie.
Hagen Kühn, Jg. 1943, ist promovierter Ökonom und habilitierter Soziologe; er arbeitete 30 Jahre am WZB und war zuletzt Co-Leiter der Forschergruppe Public Health.
1 Ursprünglich erschienen im: Jahrbuch für Kritische Medizin und Gesundheitswissenschaften, Band 49 Gesundheitspolitik in der Arbeitswelt, Hamburg 2013. Teile des Artikels erschienen als Stichwort »Kritische Medizin« im Historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus, Bd. 7 III, Berlin 2012.